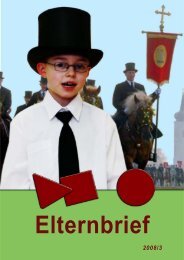Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Umgangs mit der Zweisprachigkeit in ganz<br />
anderer Weise zur Verfügung stellen: Zum<br />
einen erinnern sie an eine vergangene Zeit<br />
der Normalität von Zwei- <strong>und</strong> Mehrsprachigkeit,<br />
die erst mit dem Aufkommen der Nationalstaaten<br />
bekämpft wurde: Der Nationalstaat<br />
benötigte die eine Sprache, die in Verbindung<br />
mit der allgemeinen Schule <strong>und</strong> dem<br />
Militär zur tragenden Säule einer Vorstellung<br />
von Homogenität als der zentralen<br />
Funktion in einem Staatswesen wurde: Wilhelm<br />
von Humboldt, der große Liberale der<br />
preußischen Kultusreform, war es selbst, der<br />
diese Richtung einschlug: Letztlich schreckte<br />
er doch vor der formalen Kühle seines liberalen<br />
«Nachtwächterstaats» zurück, der nur<br />
für äußere <strong>und</strong> innere Sicherheit sorgt <strong>und</strong><br />
den Rahmen beispielsweise des Bildungssystems<br />
absteckt, sich aber im Vertrauen auf<br />
die selbstregulativen Kräfte der Gesellschaft<br />
aus den inhaltlichen Setzungen weitgehend<br />
heraushält. Er überwölbte diesen – wie auch<br />
Herder <strong>und</strong> andere – mit einem Verständnis<br />
von Nation, das sich aus der Einheit des Denkens,<br />
Fühlens, Glaubens <strong>und</strong> Sprechens heraus<br />
entwarf – <strong>und</strong> in der die von ihm doch<br />
bildungstheoretisch hochgeschätzte «Mannigfaltigkeit<br />
der Köpfe» letztlich zu einer<br />
Einheit verschmolzen werden konnte. Auf<br />
der Seite der Sprache steht am Ende dieses<br />
Prozesses die Figur des «monolingualen<br />
Habitus», wie es Ingrid Gogolin in ihrem viel<br />
zitierten Buch von 1994 nannte: Dieser monolinguale<br />
Habitus erlaubt es, von der normativen<br />
Kraft <strong>und</strong> Notwendigkeit sprachlicher<br />
Einheit auszugehen – selbst wenn die<br />
Wirklichkeit eine andere ist – nämlich mehrsprachig.<br />
Wie gesagt, die nationalen Minderheiten mit<br />
ihren über die Jahrh<strong>und</strong>erte bewahrten Sprachen<br />
repräsentieren noch etwas von dieser<br />
vergangenen Normalität der gesellschaftlichen<br />
Mehrsprachigkeit. In ihnen ist es eben<br />
«normal», beide Sprachen zu sprechen. Man<br />
mag es aber gar nicht glauben, wie viele<br />
Menschen auch in Deutschland, wenn sie<br />
zum ersten Mal von der Existenz der sorbischen<br />
Sprache <strong>und</strong> ihrer Sprecherinnen <strong>und</strong><br />
Sprecher erfahren, allen Ernstes glauben,<br />
dass Sorben in der Regel nur Sorbisch sprächen.<br />
Das Einsprachigkeitsparadigma ist so<br />
tief verankert, dass es manchen empirischen<br />
Wirklichkeiten standhält. In dieser Situation<br />
sind nationale Minderheiten aufklärend <strong>und</strong><br />
bringen eine Erkenntnisressource zum Tragen:<br />
So wissen wir, dass man in einem Staat<br />
leben kann, aber kulturell <strong>und</strong> sprachlich anders<br />
leben kann, dass man eine Sprache als<br />
wichtiger erachten kann – in diesem Fall das<br />
Sorbische – <strong>und</strong> gleichzeitig sehr gut<br />
Deutsch sprechen kann. Das beobachten wir<br />
ja bei den von uns untersuchten Kindern –<br />
doch dazu später Genaueres. Wir können lernen,<br />
dass man in allen Lebenssituationen mit<br />
zwei Sprachen zu Recht kommen kann; <strong>und</strong><br />
wir sehen historisch auch, dass nationale<br />
Minderheiten ebenfalls anpassungsfähig<br />
sind, d. h. dass sie den fortschreitenden Prozess<br />
der technischen Zivilisation ebenfalls<br />
vollziehen <strong>und</strong> dabei ihre Sprachkompetenzen<br />
nutzen.<br />
Doch wir möchten etwas genauer auf die<br />
Sprache eingehen; Ricardo Ruiz sah das<br />
Argument der Ressource viel konkreter. Er<br />
sah es als Ressource der Menschen <strong>und</strong> eben<br />
auch der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Bil-<br />
■<br />
■ 96 ■ 97<br />
■