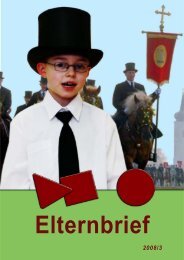Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Witaj und 2plus - Sorbischer Schulverein e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
D<br />
er amerikanische Zweitspracherwerbsforscher<br />
Ricardo Ruiz unterschied zwischen<br />
drei Ebenen, auf deren Hintergr<strong>und</strong> die Frage<br />
des Umgangs mit Zwei- <strong>und</strong> Mehrsprachigkeit<br />
zu diskutieren ist: Sprache als Defizit,<br />
Sprache als Recht <strong>und</strong> Sprache als Ressource<br />
(vgl. Ruiz 1984). Im Folgenden soll zunächst<br />
der Frage nachgegangen werden, wie sich<br />
diese Dimensionen auf die Situation sprachlicher<br />
Minderheiten in Deutschland <strong>und</strong> Europa<br />
anwenden lassen. Im Anschluss daran<br />
werden exemplarisch einige Ergebnisse aus<br />
der wissenschaftlichen Begleitung der sorbisch-deutschen<br />
Gr<strong>und</strong>schulen vorgestellt.<br />
Zweisprachigkeit als Defizit<br />
Die Diskussion über Sprachdefizite bei zweisprachigen<br />
Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen darf als<br />
bekannt voraus gesetzt werden. Weniger bekannt<br />
ist es, dass in dieser Hinsicht bis heute<br />
in Deutschland eine alte Tradition fortgesetzt<br />
wird: Schon lange gibt es nämlich durchaus<br />
einen nüchtern-positiven Blick auf Zweisprachigkeit<br />
– so sah z. B. der erste preußische<br />
Kultusminister Karl von Altenstein zwar die<br />
Notwendigkeit, dass die damalige polnischsprachige<br />
Bevölkerung die deutsche Sprache<br />
als Verkehrssprache erwerbe, aber durchaus<br />
nicht als Ersatz für ihre Muttersprache:<br />
«fi...fl der Besitz zweier Sprachen ist so<br />
wenig für einen Nachteil zu erachten,<br />
dass er vielmehr wie ein Vorzug betrachtet<br />
werden darf, da er in der Regel<br />
mit größerer Beweglichkeit der Verstandeskräfte<br />
<strong>und</strong> einer leichteren Auffassungsgabe<br />
verb<strong>und</strong>en zu sein pflegt»<br />
(zit.n.Gogolin/Krüger-Potratz 2006,56)<br />
Historische <strong>und</strong> aktuelle<br />
Perspektiven für Zwei<strong>und</strong><br />
Mehrsprachigkeit<br />
in Europa. Zum Beitrag<br />
sorbisch-deutscher<br />
Schulen mit bilingualem<br />
Unterricht.<br />
Allerdings setzte sich auch immer wieder<br />
eine negative Sicht durch, wie zum Beispiel<br />
durch den Ausdruck «Sprachverzwitterung»<br />
(vgl. ebd.); damit ist nicht anderes als Zweisprachigkeit<br />
gemeint. Interessanterweise<br />
thematisieren Diskurse, die Zweisprachigkeit<br />
negativ sehen, häufig individuelle Folgen<br />
für Kinder wie eine langsamere Sprachentwicklung,<br />
Sprachentwicklungsstörungen,<br />
allgemeines Zurückbleiben in der gesamten<br />
Entwicklung bis hin zur Krankheit, solche<br />
Diskurse tauchen jedoch auch immer dann<br />
auf, wenn es um politische Themen geht:<br />
Heute beobachten wir z. B. hinsichtlich der<br />
Zweisprachigkeit der Menschen mit Migrationshintergr<strong>und</strong><br />
eine neoassimilationistische<br />
Debatte über die Familiensprachen von<br />
Migranten als Integrationshindernisse. Anstatt<br />
über eine sinnvolle Förderung <strong>und</strong> den<br />
Ausbau der Zweisprachigkeit zu sprechen,<br />
verschiebt sich die Diskussion auf den Mangel<br />
in nur einer Sprache. Die Folgerung lautet<br />
dann: mehr Deutsch statt: mehr Zweisprachigkeit!<br />
Diese Diskussion ist aber letztlich<br />
eine politische. Auch deren Kontinuität findet<br />
man historisch gut belegt: So erschien in<br />
der Zeitschrift «Der Schulrath an der<br />
Oder»1815 ein Artikel gegen die Zweisprachigkeit<br />
mit dem Ziel, «dieses Gezwitter zu<br />
vertilgen“, wobei sich Geistliche <strong>und</strong> Schullehrer<br />
die «Hand bieten»müssten, «wenn sie<br />
es redlich mit dem Vaterlande»meinten<br />
(ebd.). Aus diesem Impuls entstand im<br />
Preußen des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts eine repressive<br />
Sprachenpolitik, deren Motivation nicht in<br />
der Sorge um das Wohl des Individuums<br />
wurzelt(e), sondern in der Sorge um die<br />
nationale Einheit: