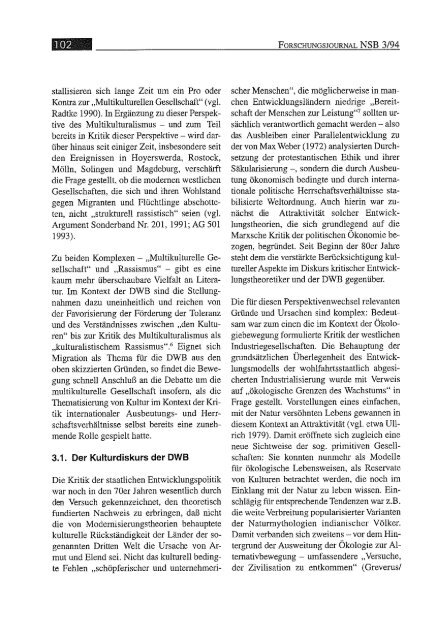Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
102 FORSCHUNGSJOURNAL NSB 3/94<br />
stallisieren sich lange Zeit um ein Pro oder<br />
Kontra zur „Multikulturellen Gesellschaft" (vgl.<br />
Radtke 1990). In Ergänzung zu dieser Perspektive<br />
des Multikulturalismus - und zum Teil<br />
bereits in Kritik dieser Perspektive - wird darüber<br />
hinaus seit einiger Zeit, insbesondere seit<br />
den Ereignissen in Hoyerswerda, Rostock,<br />
Mölln, Solingen und Magdeburg, verschärft<br />
die Frage gestellt, ob die modernen westlichen<br />
Gesellschaften, die sich und ihren Wohlstand<br />
gegen Migranten und Flüchtlinge abschotteten,<br />
nicht „strukturell rassistisch" seien (vgl.<br />
Argument Sonderband Nr. 201, 1991; AG 501<br />
1993).<br />
Zu beiden Komplexen - „Multikulturelle Gesellschaft"<br />
und „Rassismus" - gibt es eine<br />
kaum mehr überschaubare Vielfalt an Literatur.<br />
Im Kontext der DWB sind die Stellungnahmen<br />
dazu uneinheitlich und reichen von<br />
der Favorisierung der Förderung der Toleranz<br />
und des Verständnisses zwischen „den Kulturen"<br />
bis zur Kritik des Multikulturalismus als<br />
„kulturalistischem Rassismus". 6<br />
Eignet sich<br />
Migration als Thema für die DWB aus den<br />
oben skizzierten Gründen, so findet die Bewegung<br />
schnell Anschluß an die Debatte um die<br />
multikulturelle Gesellschaft insofern, als die<br />
Thematisierung von Kultur im Kontext der Kritik<br />
internationaler Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse<br />
selbst bereits eine zunehmende<br />
Rolle gespielt hatte.<br />
3.1. Der Kulturdiskurs der DWB<br />
Die Kritik der staatlichen Entwicklungspolitik<br />
war noch in den 70er Jahren wesentlich durch<br />
den Versuch gekennzeichnet, den theoretisch<br />
fundierten Nachweis zu erbringen, daß nicht<br />
die von Modernisierungstheorien behauptete<br />
kulturelle Rückständigkeit der Länder der sogenannten<br />
Dritten Welt die Ursache von Armut<br />
und Elend sei. Nicht das kulturell bedingte<br />
Fehlen „schöpferischer und unternehmeri<br />
scher Menschen", die möglicherweise in manchen<br />
Entwicklungsländern niedrige „Bereitschaft<br />
der Menschen zur Leistung" 7<br />
sollten ursächlich<br />
verantwortlich gemacht werden - also<br />
das Ausbleiben einer Parallelentwicklung zu<br />
der von Max Weber (1972) analysierten Durchsetzung<br />
der protestantischen Ethik und ihrer<br />
Säkularisierung -, sondern die durch Ausbeutung<br />
ökonomisch bedingte und durch internationale<br />
politische Herrschaftsverhältnisse stabilisierte<br />
Weltordnung. Auch hierin war zunächst<br />
die Attraktivität solcher Entwicklungstheorien,<br />
die sich grundlegend auf die<br />
Marxsche Kritik der politischen Ökonomie bezogen,<br />
begründet. Seit Beginn der 80er Jahre<br />
steht dem die verstärkte Berücksichtigung kultureller<br />
Aspekte im Diskurs kritischer Entwicklungstheoretiker<br />
und der DWB gegenüber.<br />
Die für diesen Perspektivenwechsel relevanten<br />
Gründe und Ursachen sind komplex: Bedeutsam<br />
war zum einen die im Kontext der Ökologiebewegung<br />
formulierte Kritik der westlichen<br />
Industriegesellschaften. Die Behauptung der<br />
grundsätzlichen Überlegenheit des Entwicklungsmodells<br />
der wohlfahrtsstaatlich abgesicherten<br />
Industrialisierung wurde mit Verweis<br />
auf „ökologische Grenzen des Wachstums" in<br />
Frage gestellt. Vorstellungen eines einfachen,<br />
mit der Natur versöhnten Lebens gewannen in<br />
diesem Kontext an Attraktivität (vgl. etwa Ullrich<br />
1979). Damit eröffnete sich zugleich eine<br />
neue Sichtweise der sog. primitiven Gesellschaften:<br />
Sie konnten nunmehr als Modelle<br />
für ökologische Lebensweisen, als Reservate<br />
von Kulturen betrachtet werden, die noch im<br />
Einklang mit der Natur zu leben wissen. Einschlägig<br />
für entsprechende Tendenzen war z.B.<br />
die weite Verbreitung popularisierter Varianten<br />
der Naturmythologien indianischer Völker.<br />
Damit verbanden sich zweitens - vor dem Hintergrund<br />
der Ausweitung der Ökologie zur Altemativbewegung<br />
- umfassendere „Versuche,<br />
der Zivilisation zu entkommen" (Greverus/