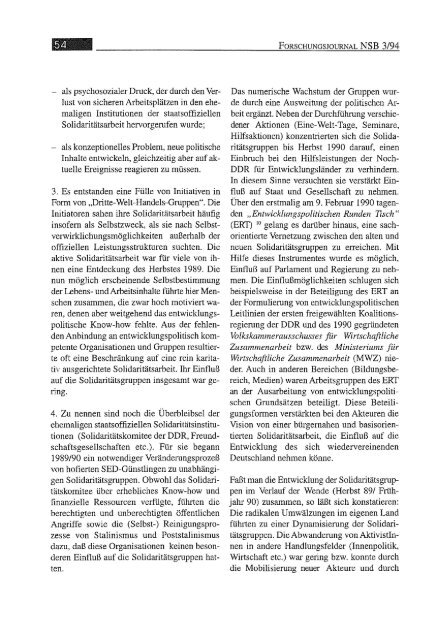Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
54 FORSCHUNGSJOURNAL NSB 3/94<br />
- als psychosozialer Druck, der durch den Verlust<br />
von sicheren Arbeitsplätzen in den ehemaligen<br />
Institutionen der staatsoffiziellen<br />
Solidaritätsarbeit hervorgerufen wurde;<br />
- als konzeptionelles Problem, neue politische<br />
Inhalte entwickeln, gleichzeitig aber auf aktuelle<br />
Ereignisse reagieren zu müssen.<br />
3. Es entstanden eine Fülle von Initiativen in<br />
Form von „Dritte-Welt-Handels-Gruppen". Die<br />
Initiatoren sahen ihre Solidaritätsarbeit häufig<br />
insofern als Selbstzweck, als sie nach Selbstverwirklichungsmöglichkeiten<br />
außerhalb der<br />
offiziellen Leistungsstrukturen suchten. Die<br />
aktive Solidaritätsarbeit war für viele von ihnen<br />
eine Entdeckung des Herbstes 1989. Die<br />
nun möglich erscheinende Selbstbestimmung<br />
der Lebens- und Arbeitsinhalte führte hier Menschen<br />
zusammen, die zwar hoch motiviert waren,<br />
denen aber weitgehend das entwicklungspolitische<br />
Know-how fehlte. Aus der fehlenden<br />
Anbindung an entwicklungspolitisch kompetente<br />
Organisationen und Gruppen resultierte<br />
oft eine Beschränkung auf eine rein karitativ<br />
ausgerichtete Solidaritätsarbeit. Ihr Einfluß<br />
auf die Solidaritätsgruppen insgesamt war gering.<br />
4. Zu nennen sind noch die Überbleibsel der<br />
ehemaligen staatsoffiziellen Solidaritätsinstitutionen<br />
(Solidaritätskomitee der DDR, Freundschaftsgesellschaften<br />
etc.). Für sie begann<br />
1989/90 ein notwendiger Veränderungsprozeß<br />
von hofierten SED-Günstlingen zu unabhängigen<br />
Solidaritätsgruppen. Obwohl das Solidaritätskomitee<br />
über erhebliches Know-how und<br />
finanzielle Ressourcen verfügte, führten die<br />
berechtigten und unberechtigten öffentlichen<br />
Angriffe sowie die (Selbst-) Reinigungsprozesse<br />
von Stalinismus und Poststalinismus<br />
dazu, daß diese Organisationen keinen besonderen<br />
Einfluß auf die Solidaritätsgruppen hatten.<br />
Das numerische Wachstum der Gruppen wurde<br />
durch eine Ausweitung der politischen Arbeit<br />
ergänzt. Neben der Durchführung verschiedener<br />
Aktionen (Eine-Welt-Tage, Seminare,<br />
Hilfsaktionen) konzentrierten sich die Solidaritätsgruppen<br />
bis Herbst 1990 darauf, einen<br />
Einbruch bei den Hilfsleistungen der Noch-<br />
DDR für Entwicklungsländer zu verhindern.<br />
In diesem Sinne versuchten sie verstärkt Einfluß<br />
auf Staat und Gesellschaft zu nehmen.<br />
Über den erstmalig am 9. Februar 1990 tagenden<br />
„Entwicklungspolitischen Runden Tisch"<br />
(ERT) 10<br />
gelang es darüber hinaus, eine sachorientierte<br />
Vernetzung zwischen den alten und<br />
neuen Solidaritätsgruppen zu erreichen. Mit<br />
Hilfe dieses Instrumentes wurde es möglich,<br />
Einfluß auf Parlament und Regierung zu nehmen.<br />
Die Einflußmöglichkeiten schlugen sich<br />
beispielsweise in der Beteiligung des ERT an<br />
der Formulierung von entwicklungspolitischen<br />
Leitlinien der ersten freigewählten Koalitionsregierung<br />
der DDR und des 1990 gegründeten<br />
Volkskammerausschusses für Wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit bzw. des Ministeriums für<br />
Wirtschaftliche Zusammenarbeit (MWZ) nieder.<br />
Auch in anderen Bereichen (Bildungsbereich,<br />
Medien) waren Arbeitsgruppen des ERT<br />
an der Ausarbeitung von entwicklungspolitischen<br />
Grundsätzen beteiligt. Diese Beteiligungsformen<br />
verstärkten bei den Akteuren die<br />
Vision von einer bürgernahen und basisorientierten<br />
Solidaritätsarbeit, die Einfluß auf die<br />
Entwicklung des sich wiedervereinenden<br />
Deutschland nehmen könne.<br />
Faßt man die Entwicklung der Solidaritätsgruppen<br />
im Verlauf der Wende (Herbst 89/ Frühjahr<br />
90) zusammen, so läßt sich konstatieren:<br />
Die radikalen Umwälzungen im eigenen Land<br />
führten zu einer Dynamisierung der Solidaritätsgruppen.<br />
Die Abwanderung von Aktivistinnen<br />
in andere Handlungsfelder (Innenpolitik,<br />
Wirtschaft etc.) war gering bzw. konnte durch<br />
die Mobilisierung neuer Akteure und durch