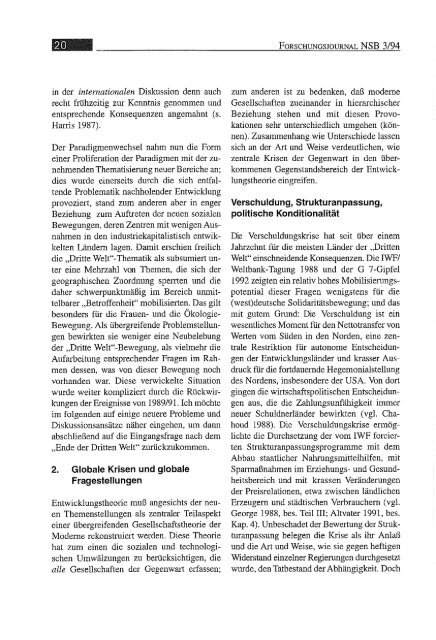Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (6.51 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
20 FORSCHUNGSJOURNAL NSB 3/94<br />
in der internationalen Diskussion denn auch<br />
recht frühzeitig zur Kenntnis genommen und<br />
entsprechende Konsequenzen angemahnt (s.<br />
Harris 1987).<br />
Der Paradigmenwechsel nahm nun die Form<br />
einer Proliferation der Paradigmen mit der zunehmenden<br />
Thematisierung neuer Bereiche an;<br />
dies wurde einerseits durch die sich entfaltende<br />
Problematik nachholender Entwicklung<br />
provoziert, stand zum anderen aber in enger<br />
Beziehung zum Auftreten der neuen sozialen<br />
<strong>Bewegungen</strong>, deren Zentren mit wenigen Ausnahmen<br />
in den industriekapitalistisch entwikkelten<br />
Ländern lagen. Damit erschien freilich<br />
die „Dritte Welt"-Thematik als subsumiert unter<br />
eine Mehrzahl von Themen, die sich der<br />
geographischen Zuordnung sperrten und die<br />
daher schwerpunktmäßig im Bereich unmittelbarer<br />
„Betroffenheit" mobilisierten. Das gilt<br />
besonders für die Frauen- und die Ökologie-<br />
Bewegung. Als übergreifende Problemstellungen<br />
bewirkten sie weniger eine Neubelebung<br />
der „Dritte Welt"-Bewegung, als vielmehr die<br />
Aufarbeitung entsprechender Fragen im Rahmen<br />
dessen, was von dieser Bewegung noch<br />
vorhanden war. Diese verwickelte Situation<br />
wurde weiter kompliziert durch die Rückwirkungen<br />
der Ereignisse von 1989/91. Ich möchte<br />
im folgenden auf einige neuere Probleme und<br />
Diskussionsansätze näher eingehen, um dann<br />
abschließend auf die Eingangsfrage nach dem<br />
„Ende der Dritten Welt" zurückzukommen.<br />
2. Globale Krisen und globale<br />
Fragestellungen<br />
Entwicklungstheorie muß angesichts der neuen<br />
Themenstellungen als zentraler Teilaspekt<br />
einer übergreifenden Gesellschaftstheorie der<br />
Moderne rekonstruiert werden. Diese Theorie<br />
hat zum einen die sozialen und technologischen<br />
Umwälzungen zu berücksichtigen, die<br />
alle Gesellschaften der Gegenwart erfassen;<br />
zum anderen ist zu bedenken, daß moderne<br />
Gesellschaften zueinander in hierarchischer<br />
Beziehung stehen und mit diesen Provokationen<br />
sehr unterschiedlich umgehen (können).<br />
Zusammenhang wie Unterschiede lassen<br />
sich an der Art und Weise verdeutlichen, wie<br />
zentrale Krisen der Gegenwart in den überkommenen<br />
Gegenstandsbereich der Entwicklungstheorie<br />
eingreifen.<br />
Verschuldung, Strukturanpassung,<br />
politische Konditionalität<br />
Die Verschuldungskrise hat seit über einem<br />
Jahrzehnt für die meisten Länder der „Dritten<br />
Welt" einschneidende Konsequenzen. Die IWF/<br />
Weltbank-Tagung 1988 und der G 7-Gipfel<br />
1992 zeigten ein relativ hohes Mobilisierungspotential<br />
dieser Fragen wenigstens für die<br />
(west)deutsche Solidaritätsbewegung; und das<br />
mit gutem Grund: Die Verschuldung ist ein<br />
wesentliches Moment für den Nettotransfer von<br />
Werten vom Süden in den Norden, eine zentrale<br />
Restriktion für autonome Entscheidungen<br />
der Entwicklungsländer und krasser Ausdruck<br />
für die fortdauernde Hegemonialstellung<br />
des Nordens, insbesondere der USA. Von dort<br />
gingen die wirtschaftspolitischen Entscheidungen<br />
aus, die die Zahlungsunfähigkeit immer<br />
neuer Schuldnerländer bewirkten (vgl. Chahoud<br />
1988). Die Verschuldungskrise ermöglichte<br />
die Durchsetzung der vom IWF forcierten<br />
Strukturanpassungsprogramme mit dem<br />
Abbau staatlicher Nahrungsmittelhilfen, mit<br />
Sparmaßnahmen im Erziehungs- und Gesundheitsbereich<br />
und mit krassen Veränderungen<br />
der Preisrelationen, etwa zwischen ländlichen<br />
Erzeugern und städtischen Verbrauchern (vgl.<br />
George 1988, bes. Teil III; Altvater 1991, bes.<br />
Kap. 4). Unbeschadet der Bewertung der Strukturanpassung<br />
belegen die Krise als ihr Anlaß<br />
und die Art und Weise, wie sie gegen heftigen<br />
Widerstand einzelner Regierungen durchgesetzt<br />
wurde, den Tatbestand der Abhängigkeit. Doch