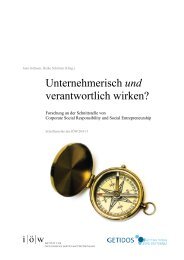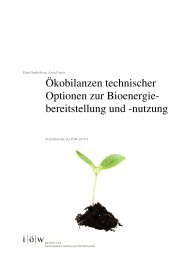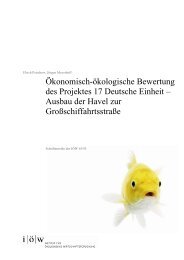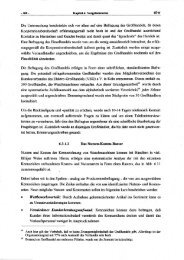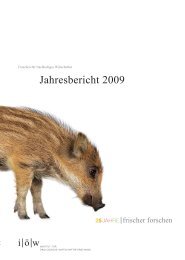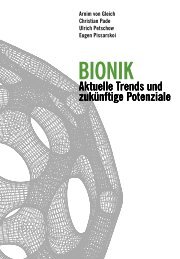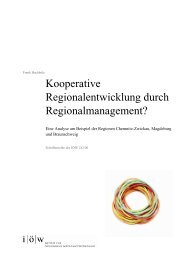Was kostet ein Schnitzel wirklich? - Institut für ökologische ...
Was kostet ein Schnitzel wirklich? - Institut für ökologische ...
Was kostet ein Schnitzel wirklich? - Institut für ökologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
52<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>ökologische</strong> Wirtschaftsforschung (IÖW)<br />
können die Tiere ausgiebig im Stroh wühlen und haben deutlich mehr Platz als ihre konventionell<br />
gehaltenen Artgenossen (z.B. 1,3 m 2 Stallfläche und 1,0 m 2 im Außenbereich <strong>für</strong><br />
<strong>ein</strong> 85 - 110 kg schweres Schw<strong>ein</strong>, nach Richtlinie Nr. 2092/91/EWG). Aufgrund der ausreichenden<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten, kommt es nur sehr selten zu Verletzungen unter<br />
den Schw<strong>ein</strong>en. Auch B<strong>ein</strong>- und Klauenverletzungen treten infolge des artgerechteren Bodens<br />
sehr selten auf (Kress et al. 2003, BUND 2003). Das prophylaktische Kupieren der<br />
Schwänze und Abkneifen der Zähne ist nicht erlaubt (Richtlinie Nr. 2092/91/EWG).<br />
Fazit: Die zulässige Haltungsform der konventionellen Modellbetriebe [konv] und<br />
[konv.plus] ist unter dem Gesichtspunkt der Tiergerechtheit kritisch zu bewerten. Nach<br />
M<strong>ein</strong>ung des BUND (2003) genügen sie in Teilen nicht <strong>ein</strong>mal den Anforderungen des Tierschutzgesetztes.<br />
Die Tiergerechtheit der Haltungsbedingungen im <strong>ökologische</strong>n Landbau –<br />
und damit der Modellbetriebe [öko] und [öko.plus] - ist dagegen deutlich höher.<br />
5.1.2 Stallklima<br />
Aus Gründen der Energieersparnis werden viele konventionelle Stallungen v.a. im Winter<br />
schlecht gelüftet (Bartussek et al. 2001) und haben daher <strong>ein</strong>e schlechte Luftqualität. Der<br />
sehr komplexe Zusammenhang zwischen Stallluftqualität, Atemwegserkrankungen und<br />
Mastleistung ist bisher noch wenig erforscht. Ein schlechtes Stallklima kann jedoch zu gehäuftem<br />
Auftreten von respiratorischen Erkrankungen und/oder Kannibalismus (z.B.<br />
Schwanzbeißen) führen (Kalich 1980). Bartussek et al. (2001) konnten durch Untersuchungen<br />
nachweisen, dass es durch schlechte Luftqualität zu <strong>ein</strong>er signifikanten Verringerung<br />
der Futteraufnahme bzw. Futterverwertung und somit zu geringeren Tageszunahmen<br />
kommt.<br />
Verbunden mit <strong>ein</strong>em schlechten Stallklima sind hohe Staub- und Ammoniakkonzentrationen,<br />
die in ihrer Schadstoffwirkung die Tiergesundheit be<strong>ein</strong>trächtigen. Wie<br />
stallklimatische Untersuchungen (nach Mayer 1999) ergaben, herrschen in zwangsgelüfteten<br />
und wärmegedämmten Ställen (mit Vollspaltensystemen) deutlich höhere<br />
Ammoniak- und Staubkonzentrationen vor als in den Außenklimaställen der <strong>ökologische</strong>n<br />
Schw<strong>ein</strong>ehaltung. Die höchsten Konzentrationen wurden dabei im Winter gemessen, wenn<br />
die Ställe schlechter bzw. kaum gelüftet werden. In dieser Zeit war die Belastung der Tiere,<br />
die aus den Faktoren “Zeitdauer“ und “Überschreitungshöhe des Grenzwertes 9 “ berechnet<br />
wurde, am höchsten. Die geringere Belastung der frei gelüfteten Außenklimaställe kann<br />
dadurch erklärt werden, dass aufgrund der niedrigeren Temperaturen weniger Ammoniak<br />
durch mikrobielle Umsetzungsprozesse entsteht als es in den wärmegedämmten Ställen.<br />
Fazit: Die Außenklimaställe der <strong>ökologische</strong>n Schw<strong>ein</strong>haltung der Modellbetriebe [öko]<br />
und [öko.plus] weisen <strong>ein</strong> besseres Stallklima als die konventionellen wärmegedämmten<br />
Ställe der Modellbetriebe [konv] und [konv.plus] auf und tragen somit erkennbar zum<br />
Wohlbefinden der Tiere bei.<br />
9 Gemäß der gültigen Schw<strong>ein</strong>ehaltungsverordnung (SHVO) liegt der Grenzwert bei 20 ppm NH3 im Aufenthaltsbereich<br />
der Schw<strong>ein</strong>e. Aus Gründen der gesundheitlichen Belastung von Tier und Mensch sollte<br />
<strong>ein</strong>e Festsetzung der Maximalkonzentration auf 10 ppm NH 3 erfolgen, wie es in der Schweiz bereits der<br />
Fall ist (Mayer 1999).