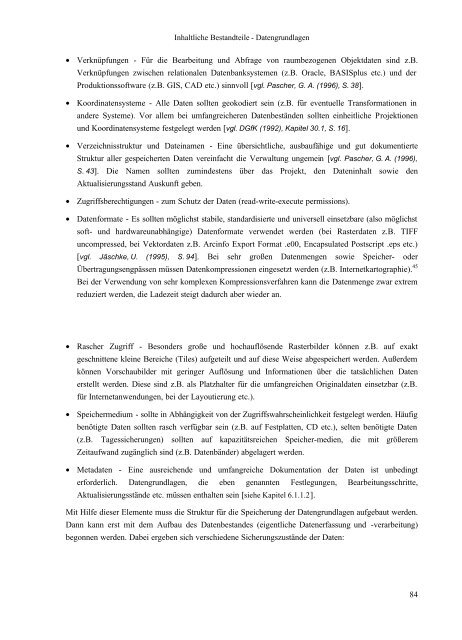Redaktionsfragen - Carto:net
Redaktionsfragen - Carto:net
Redaktionsfragen - Carto:net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhaltliche Bestandteile - Datengrundlagen<br />
• Verknüpfungen - Für die Bearbeitung und Abfrage von raumbezogenen Objektdaten sind z.B.<br />
Verknüpfungen zwischen relationalen Datenbanksystemen (z.B. Oracle, BASISplus etc.) und der<br />
Produktionssoftware (z.B. GIS, CAD etc.) sinnvoll [vgl. Pascher, G. A. (1996), S. 38].<br />
• Koordinatensysteme - Alle Daten sollten geokodiert sein (z.B. für eventuelle Transformationen in<br />
andere Systeme). Vor allem bei umfangreicheren Datenbeständen sollten einheitliche Projektionen<br />
und Koordinatensysteme festgelegt werden [vgl. DGfK (1992), Kapitel 30.1, S. 16].<br />
• Verzeichnisstruktur und Dateinamen - Eine übersichtliche, ausbaufähige und gut dokumentierte<br />
Struktur aller gespeicherten Daten vereinfacht die Verwaltung ungemein [vgl. Pascher, G. A. (1996),<br />
S. 43]. Die Namen sollten zumindestens über das Projekt, den Dateninhalt sowie den<br />
Aktualisierungsstand Auskunft geben.<br />
• Zugriffsberechtigungen - zum Schutz der Daten (read-write-execute permissions).<br />
• Datenformate - Es sollten möglichst stabile, standardisierte und universell einsetzbare (also möglichst<br />
soft- und hardwareunabhängige) Datenformate verwendet werden (bei Rasterdaten z.B. TIFF<br />
uncompressed, bei Vektordaten z.B. Arcinfo Export Format .e00, Encapsulated Postscript .eps etc.)<br />
[vgl. Jäschke, U. (1995), S. 94]. Bei sehr großen Datenmengen sowie Speicher- oder<br />
Übertragungsengpässen müssen Datenkompressionen eingesetzt werden (z.B. Inter<strong>net</strong>kartographie). 45<br />
Bei der Verwendung von sehr komplexen Kompressionsverfahren kann die Datenmenge zwar extrem<br />
reduziert werden, die Ladezeit steigt dadurch aber wieder an.<br />
• Rascher Zugriff - Besonders große und hochauflösende Rasterbilder können z.B. auf exakt<br />
geschnittene kleine Bereiche (Tiles) aufgeteilt und auf diese Weise abgespeichert werden. Außerdem<br />
können Vorschaubilder mit geringer Auflösung und Informationen über die tatsächlichen Daten<br />
erstellt werden. Diese sind z.B. als Platzhalter für die umfangreichen Originaldaten einsetzbar (z.B.<br />
für Inter<strong>net</strong>anwendungen, bei der Layoutierung etc.).<br />
• Speichermedium - sollte in Abhängigkeit von der Zugriffswahrscheinlichkeit festgelegt werden. Häufig<br />
benötigte Daten sollten rasch verfügbar sein (z.B. auf Festplatten, CD etc.), selten benötigte Daten<br />
(z.B. Tagessicherungen) sollten auf kapazitätsreichen Speicher-medien, die mit größerem<br />
Zeitaufwand zugänglich sind (z.B. Datenbänder) abgelagert werden.<br />
• Metadaten - Eine ausreichende und umfangreiche Dokumentation der Daten ist unbedingt<br />
erforderlich. Datengrundlagen, die eben genannten Festlegungen, Bearbeitungsschritte,<br />
Aktualisierungsstände etc. müssen enthalten sein [siehe Kapitel 6.1.1.2].<br />
Mit Hilfe dieser Elemente muss die Struktur für die Speicherung der Datengrundlagen aufgebaut werden.<br />
Dann kann erst mit dem Aufbau des Datenbestandes (eigentliche Datenerfassung und -verarbeitung)<br />
begonnen werden. Dabei ergeben sich verschiedene Sicherungszustände der Daten:<br />
84