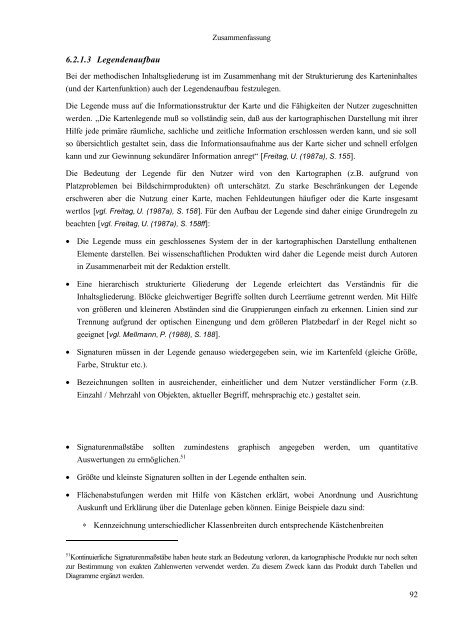Redaktionsfragen - Carto:net
Redaktionsfragen - Carto:net
Redaktionsfragen - Carto:net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6.2.1.3 Legendenaufbau<br />
Zusammenfassung<br />
Bei der methodischen Inhaltsgliederung ist im Zusammenhang mit der Strukturierung des Karteninhaltes<br />
(und der Kartenfunktion) auch der Legendenaufbau festzulegen.<br />
Die Legende muss auf die Informationsstruktur der Karte und die Fähigkeiten der Nutzer zugeschnitten<br />
werden. „Die Kartenlegende muß so vollständig sein, daß aus der kartographischen Darstellung mit ihrer<br />
Hilfe jede primäre räumliche, sachliche und zeitliche Information erschlossen werden kann, und sie soll<br />
so übersichtlich gestaltet sein, dass die Informationsaufnahme aus der Karte sicher und schnell erfolgen<br />
kann und zur Gewinnung sekundärer Information anregt“ [Freitag, U. (1987a), S. 155].<br />
Die Bedeutung der Legende für den Nutzer wird von den Kartographen (z.B. aufgrund von<br />
Platzproblemen bei Bildschirmprodukten) oft unterschätzt. Zu starke Beschränkungen der Legende<br />
erschweren aber die Nutzung einer Karte, machen Fehldeutungen häufiger oder die Karte insgesamt<br />
wertlos [vgl. Freitag, U. (1987a), S. 158]. Für den Aufbau der Legende sind daher einige Grundregeln zu<br />
beachten [vgl. Freitag, U. (1987a), S. 158ff]:<br />
• Die Legende muss ein geschlossenes System der in der kartographischen Darstellung enthaltenen<br />
Elemente darstellen. Bei wissenschaftlichen Produkten wird daher die Legende meist durch Autoren<br />
in Zusammenarbeit mit der Redaktion erstellt.<br />
• Eine hierarchisch strukturierte Gliederung der Legende erleichtert das Verständnis für die<br />
Inhaltsgliederung. Blöcke gleichwertiger Begriffe sollten durch Leerräume getrennt werden. Mit Hilfe<br />
von größeren und kleineren Abständen sind die Gruppierungen einfach zu erkennen. Linien sind zur<br />
Trennung aufgrund der optischen Einengung und dem größeren Platzbedarf in der Regel nicht so<br />
geeig<strong>net</strong> [vgl. Mellmann, P. (1988), S. 188].<br />
• Signaturen müssen in der Legende genauso wiedergegeben sein, wie im Kartenfeld (gleiche Größe,<br />
Farbe, Struktur etc.).<br />
• Bezeichnungen sollten in ausreichender, einheitlicher und dem Nutzer verständlicher Form (z.B.<br />
Einzahl / Mehrzahl von Objekten, aktueller Begriff, mehrsprachig etc.) gestaltet sein.<br />
• Signaturenmaßstäbe sollten zumindestens graphisch angegeben werden, um quantitative<br />
Auswertungen zu ermöglichen. 51<br />
• Größte und kleinste Signaturen sollten in der Legende enthalten sein.<br />
• Flächenabstufungen werden mit Hilfe von Kästchen erklärt, wobei Anordnung und Ausrichtung<br />
Auskunft und Erklärung über die Datenlage geben können. Einige Beispiele dazu sind:<br />
∗ Kennzeichnung unterschiedlicher Klassenbreiten durch entsprechende Kästchenbreiten<br />
51 Kontinuierliche Signaturenmaßstäbe haben heute stark an Bedeutung verloren, da kartographische Produkte nur noch selten<br />
zur Bestimmung von exakten Zahlenwerten verwendet werden. Zu diesem Zweck kann das Produkt durch Tabellen und<br />
Diagramme ergänzt werden.<br />
92