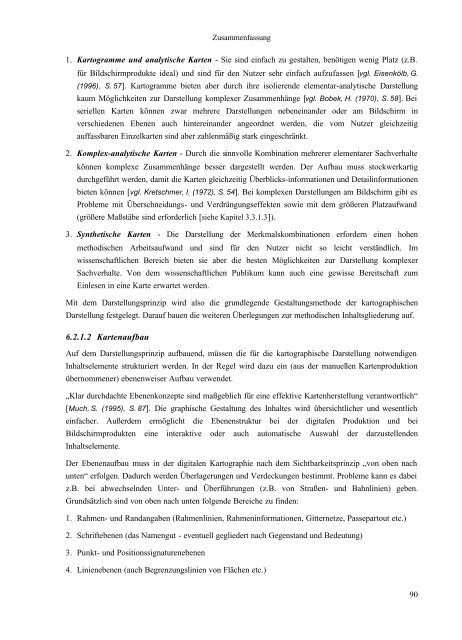Redaktionsfragen - Carto:net
Redaktionsfragen - Carto:net
Redaktionsfragen - Carto:net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zusammenfassung<br />
1. Kartogramme und analytische Karten - Sie sind einfach zu gestalten, benötigen wenig Platz (z.B.<br />
für Bildschirmprodukte ideal) und sind für den Nutzer sehr einfach aufzufassen [vgl. Eisenkölb, G.<br />
(1996), S. 57]. Kartogramme bieten aber durch ihre isolierende elementar-analytische Darstellung<br />
kaum Möglichkeiten zur Darstellung komplexer Zusammenhänge [vgl. Bobek, H. (1970), S. 58]. Bei<br />
seriellen Karten können zwar mehrere Darstellungen nebeneinander oder am Bildschirm in<br />
verschiedenen Ebenen auch hintereinander angeord<strong>net</strong> werden, die vom Nutzer gleichzeitig<br />
auffassbaren Einzelkarten sind aber zahlenmäßig stark eingeschränkt.<br />
2. Komplex-analytische Karten - Durch die sinnvolle Kombination mehrerer elementarer Sachverhalte<br />
können komplexe Zusammenhänge besser dargestellt werden. Der Aufbau muss stockwerkartig<br />
durchgeführt werden, damit die Karten gleichzeitig Überblicks-informationen und Detailinformationen<br />
bieten können [vgl. Kretschmer, I. (1972), S. 54]. Bei komplexen Darstellungen am Bildschirm gibt es<br />
Probleme mit Überschneidungs- und Verdrängungseffekten sowie mit dem größeren Platzaufwand<br />
(größere Maßstäbe sind erforderlich [siehe Kapitel 3.3.1.3]).<br />
3. Synthetische Karten - Die Darstellung der Merkmalskombinationen erfordern einen hohen<br />
methodischen Arbeitsaufwand und sind für den Nutzer nicht so leicht verständlich. Im<br />
wissenschaftlichen Bereich bieten sie aber die besten Möglichkeiten zur Darstellung komplexer<br />
Sachverhalte. Von dem wissenschaftlichen Publikum kann auch eine gewisse Bereitschaft zum<br />
Einlesen in eine Karte erwartet werden.<br />
Mit dem Darstellungsprinzip wird also die grundlegende Gestaltungsmethode der kartographischen<br />
Darstellung festgelegt. Darauf bauen die weiteren Überlegungen zur methodischen Inhaltsgliederung auf.<br />
6.2.1.2 Kartenaufbau<br />
Auf dem Darstellungsprinzip aufbauend, müssen die für die kartographische Darstellung notwendigen<br />
Inhaltselemente strukturiert werden. In der Regel wird dazu ein (aus der manuellen Kartenproduktion<br />
übernommener) ebenenweiser Aufbau verwendet.<br />
„Klar durchdachte Ebenenkonzepte sind maßgeblich für eine effektive Kartenherstellung verantwortlich“<br />
[Much, S. (1995), S. 87]. Die graphische Gestaltung des Inhaltes wird übersichtlicher und wesentlich<br />
einfacher. Außerdem ermöglicht die Ebenenstruktur bei der digitalen Produktion und bei<br />
Bildschirmprodukten eine interaktive oder auch automatische Auswahl der darzustellenden<br />
Inhaltselemente.<br />
Der Ebenenaufbau muss in der digitalen Kartographie nach dem Sichtbarkeitsprinzip „von oben nach<br />
unten“ erfolgen. Dadurch werden Überlagerungen und Verdeckungen bestimmt. Probleme kann es dabei<br />
z.B. bei abwechselnden Unter- und Überführungen (z.B. von Straßen- und Bahnlinien) geben.<br />
Grundsätzlich sind von oben nach unten folgende Bereiche zu finden:<br />
1. Rahmen- und Randangaben (Rahmenlinien, Rahmeninformationen, Gitter<strong>net</strong>ze, Passepartout etc.)<br />
2. Schriftebenen (das Namengut - eventuell gegliedert nach Gegenstand und Bedeutung)<br />
3. Punkt- und Positionssignaturenebenen<br />
4. Linienebenen (auch Begrenzungslinien von Flächen etc.)<br />
90