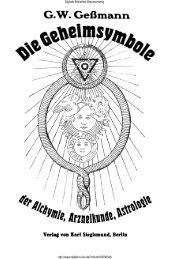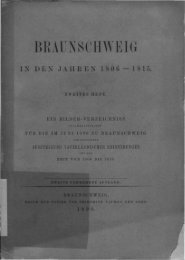Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
Die Untersuchung der Besatzdichten bei Versuchsende erbrachte sehr unterschiedliche<br />
Ergebnisse (siehe Tab. 6). Lediglich in einem der 6 daraufhin untersuchten Versuche (Versuch<br />
8, Versuch in Glasröhren) wurde eine Korrelation <strong>zwischen</strong> den Besatzdichten bei<br />
Versuchsbeginn <strong>und</strong> Versuchsende festgestellt (Signifikanzniveau 95%; siehe Tab. 13), was<br />
überrascht.<br />
Zunächst sollen die Ergebnisse in Substrat ohne Zusatz organischen Materials betrachtet<br />
werden, wobei in allen hier überprüften Versuchen Folsomia candida eingesetzt<br />
wurde. Die Besatzzahlen zu Versuchsbeginn lagen bei 17 bis 400 Tieren/100g Substrat.<br />
Beim LUFA 2.1-Substrat lagen die Besatzzahlen eines Weckglasversuches nach 146 bzw.<br />
147 Tagen Versuchsdauer bei durchschnittlich 1,9 bis 5,2 Individuen pro 100g Boden (Versuche<br />
2 <strong>und</strong> 3; Anfangsbesatz: jeweils 167 <strong>und</strong> 333 Tiere). Beim Substrat von der Braunschweiger<br />
Versuchsfläche lagen die Zahlen für einen Weckglasversuch nach 97 Tagen bei<br />
0,2 bis 4,3 pro 100g Substrat (Versuch 5; Anfangsbesatz: 17, 33 <strong>und</strong> 67 Tiere), bei den<br />
Röhrenversuchen ergaben sich nach 11 Tagen im Mittel Dichten von 38 bzw. 42,4 Tieren<br />
pro 100g (Versuch 4; Anfangsbesatz: 100 <strong>und</strong> 200 Tiere), nach 62 Tagen von 22 bis 38<br />
Individuen pro 100g (Versuch 8; Anfangsbesatz: 20, 50, 100 <strong>und</strong> 200 Tiere), nach 102<br />
Tagen von 10,5 bis 18,5 Tiere pro 100g Substrat (Versuch 6; Anfangsbesatz: 80, 200 <strong>und</strong><br />
400 Tiere).<br />
Demnach nahmen die Tierzahlen ohne Zugabe organischer Substanz mit zunehmender<br />
Versuchsdauer ab (Ausnahme: Versuch 8 – Gefäße mit Anfangsbesatz von 20 Tieren, bei<br />
Versuchsabschluss nach 62 Tagen durchschnittlich 22 Tiere). Es fand offenbar keine<br />
Reproduktion statt, die eingesetzten Adulten starben nach <strong>und</strong> nach. Auch MEBES (1999)<br />
stellte in einem Versuch mit je 20 <strong>Collembolen</strong>-Individuen unterschiedlicher Arten in 100g<br />
Substrat von einer Ackerfläche nach 22 Wochen für die meisten Arten einen Ab<strong>und</strong>anzrückgang<br />
fest. SNIDER (1971) gab die mittlere Lebensdauer für Folsomia candida mit 136<br />
Tagen an, die maximale Lebensdauer mit 198 Tagen. FOUNTAIN UND HOPKIN (2005) berichten<br />
von einer durchschnittlichen Lebensdauer von 240 Tagen bei 15 o C <strong>und</strong> von 111 Tagen<br />
bei 24 o C an. Die Tiere waren in der vorliegenden Untersuchung bei Versuchsbeginn 21<br />
Tage alt. Die meisten eingesetzten Tiere erreichten also die mittlere Lebensdauer nicht.<br />
Nach den langen Versuchsdauern waren die eingesetzten Tiere nicht mehr von eventuellen<br />
Nachkommen zu unterscheiden. Wenn eine Reproduktion erfolgt ist, dann konnte durch<br />
diese jedenfalls die ursprüngliche Besatzdichte nicht aufrechterhalten <strong>und</strong> schon gar nicht<br />
erhöht werden. Frisea mirabilis frisst nach Berichten von GISIN (1960) <strong>und</strong> PETERSEN (1971)<br />
<strong>Collembolen</strong>-Eier. GREEN (1964b) beobachtete Eikannibalismus auch bei F. candida. Möglicherweise<br />
kam es im vorliegenden Versuch durch die sehr hohen Besatzdichten <strong>und</strong> das<br />
geringe Nahrungsangebot dazu, dass Eier durch die adulten Tiere gefressen wurden. Laut<br />
GREEN (1964a) ist zudem eine Inhibition der Oviposition bei Überbevölkerung zu beobachten.<br />
Nach Beobachtung in den Laborzuchten kann dies bestätigt werden, tritt aber bei<br />
ansonsten optimalen Lebensbedingungen erst bei extrem hohen Besatzdichten auf, die in<br />
den Versuchssubstraten in keinem Fall erreicht wurden. Nach MILNE (1960) wird die Fertilität<br />
durch Stress im Wettbewerb um Lebensraum eingeschränkt, nach USHER ET AL. (1971) sind<br />
jedoch die Nahrungsressourcen der limitierende Faktor. Auch nach DRAHEIM UND LARINK<br />
(1995) beeinflusst die Qualität der Nahrung den Zeitpunkt der Eiablage <strong>und</strong> die Zahl der<br />
abgelegten Eier bei F. candida, P. minuta <strong>und</strong> S. coeca. SMITH (1997) stellte in einem<br />
Laborversuch Einflüsse von Temperatur, Feuchtigkeit, Nahrungsangebot <strong>und</strong> Substrat auf<br />
die Populationsentwicklung von 7 <strong>Collembolen</strong>arten fest.<br />
Das gemittelte Temperaturoptimum für F. candida liegt laut THIMM (1993) bei 21,1 o C, also in<br />
dem für die Versuche gewählten Temperaturbereich (20±1 o C), so dass dieser Faktor die<br />
Überlebensrate vermutlich nicht beeinflusst hat.<br />
103