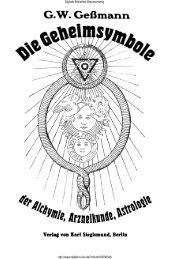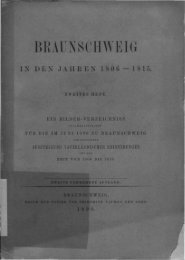Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
Das Versuchsdesign der vorliegenden Untersuchung erfüllt die Anforderungen, die<br />
ANDERSON (1978) stellte: Die Interaktion von Arten sollte seiner Ansicht nach in natürlichem<br />
Boden mit einem natürlichen Mikroorganismen-Besatz untersucht werden (eine Ausnahme<br />
bildeten die autoklavierten Versuchsansätze, die keinen natürlichen Mikroorganismen-<br />
Besatz mehr besaßen). JAGERS OP AKKERHUIS (1993) hält eine Übertragbarkeit von Laborergebnissen<br />
von Toxizitätstests auf Freilandverhältnisse dann für möglich, wenn die physikalischen<br />
Bedingungen, das Verhalten der Arthropoden <strong>und</strong> die Exposition der Tiere den<br />
natürlichen Bedingungen entsprechen (oder wenn diese für den Versuch keine Relevanz<br />
haben). Nach meiner Ansicht lässt sich dies auf Tests über <strong>Wechselwirkungen</strong> <strong>zwischen</strong><br />
Tieren <strong>und</strong> <strong>verschiedenen</strong> Bodenparametern übertragen. Die geforderten Voraussetzungen<br />
werden durch das vorgestellte Versuchsdesign erfüllt. Auch HÅGVAR führte 1988 aus, dass<br />
Studien unter kontrollierten Laborbedingungen oft notwendig sind, um die Bedeutung eines<br />
oder mehrerer Faktoren im Ökosystem zu identifizieren. Freilanduntersuchungen sind<br />
zudem aufwändig <strong>und</strong> teuer. Er ist der Meinung, dass mit Hilfe von Mikrokosmosversuchen<br />
wertvolle Informationen gewonnen werden können. Er hält allerdings ebenfalls die sehr<br />
künstlichen Bedingungen, unter denen manche Laborversuche stattfanden, für problematisch.<br />
Er empfiehlt die hier verwendete Methode, Tiere in natürlichen, tierfrei gemachten<br />
Boden per Hand einzusetzen, als sehr vorteilhaft. VERHOEF UND VAN GESTEL (1995) sehen im<br />
Zusammenhang mit ökotoxikologischen Untersuchungen einen Vorteil in der Verwendung<br />
von standardisiert vorbereitetem Substrat gegenüber der Verwendung von intakten<br />
Bodenkernen, da so die Variabilität <strong>zwischen</strong> den Wiederholungen vermindert werden kann.<br />
Das Wirkungsgefüge innerhalb der Bodenbiozönose ist sehr vielfältig <strong>und</strong> in seiner Gesamtheit<br />
schwer zu erfassen. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e wurden in der vorliegenden Untersuchung<br />
in den Versuchsgefäßen unterschiedliche Versuchsbedingungen geschaffen, <strong>und</strong><br />
verschiedene Parameter in Abhängigkeit von diesen Bedingungen untersucht.<br />
Insgesamt wurden 22 Versuche durchgeführt. Die Versuchsansätze innerhalb jedes Einzelversuches<br />
sollten sich (meist) jeweils nur in einem Merkmal unterscheiden (z.B. unterschiedlicher<br />
Tierbesatz bei ansonsten gleichen Bedingungen). Zwischen den Versuchen<br />
gab es weitere Unterschiede. So wurde mit unterschiedlichen Gefäßen, Versuchssubstraten,<br />
mit oder ohne Zusatz organischer Substanz, autoklaviert oder nicht autoklaviert, mit<br />
einem Bodenpilz beimpft oder nicht, gearbeitet. Der besondere Vorteil der Mikrokosmosuntersuchungen<br />
lag in der Möglichkeit, die verschiedensten Randbedingungen der Versuche<br />
zu variieren <strong>und</strong> die Auswirkungen vergleichend zu betrachten. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong><br />
erscheint die Wahl der Untersuchungsmethode berechtigt. Aus meiner Sicht zeigt die vorliegende<br />
Untersuchung, dass sich einige gr<strong>und</strong>legende Phänomene gut mit Hilfe von<br />
Gefäßversuchen nachweisen lassen. Hier zum Beispiel insbesondere der Vergleich der<br />
Verhältnisse unter Ausschluss bzw. beim Einsatz von Tieren <strong>und</strong> die Effekte durch den Einsatz<br />
von <strong>Collembolen</strong> nach Autoklavieren des Substrates. Nur so ist eindeutig festzustellen,<br />
dass die Tiere tatsächlich den Boden inokulieren.<br />
Diese <strong>und</strong> die Untersuchungen anderer Autoren haben wiederholt gezeigt, dass zahlreiche<br />
biologische, physikalische <strong>und</strong> chemische Parameter die <strong>Wechselwirkungen</strong> innerhalb der<br />
Bodenbiozönose beeinflussen. Diese Parameter sind unter Laborbedingungen leichter zu<br />
erfassen <strong>und</strong> zu beeinflussen als im Freiland. Nach VREEKEN-BUIJS (1998) lassen Pobennahmen<br />
im Freiland in erster Linie Rückschlüsse auf den Einfluss von Umweltbedingungen<br />
auf die Tiere zu. Um aber Rückschlüsse auf die Einflüsse der Tiere auf den Boden zu ziehen,<br />
sind ihrer Ansicht nach Mikro- oder Mesokosmos-Untersuchungen im Labor notwendig.<br />
Laborversuche stellen somit eine sehr gute Ergänzung zu Freilanduntersuchungen dar.<br />
Auch LARINK (1997) hält Mikro- <strong>und</strong> Mesokosmos-Untersuchungen für wertvoll, um das biotische<br />
System des Bodens zu verstehen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen für Modellierungen zu liefern.<br />
Ein Vergleich der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung mit Ergebnissen von Freilanduntersuchungen<br />
hat eine Reihe von Übereinstimmungen deutlich gemacht. Bei aller<br />
138