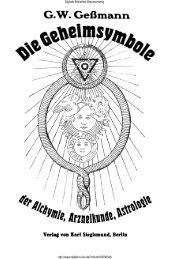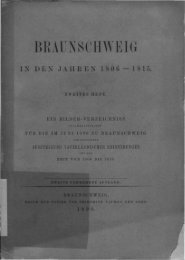Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
fungiert. Chemorezeptoren finden sich hauptsächlich am 3. Antennenglied, während<br />
Tasthaare über den ganzen Körper verteilt sind (DUNGER 1983, BELLINGER ET AL. 1996-<br />
2005).<br />
Jedes der 3 Thoraxsegmente trägt ein Beinpaar.<br />
Von den 6 Abdominalsegmenten trägt das erste den Ventraltubus. Dieses Multifunktionsorgan<br />
ist mit Hygro-, Osmo- <strong>und</strong> vermutlich Azidorezeptoren ausgerüstet (EISENBEIS UND<br />
WICHARD 1985). Es dient wahrscheinlich dem Gasaustausch sowie der Aufnahme von<br />
Wasser <strong>und</strong> niedermolekularen Verbindungen. Daneben ist es Sekretions- <strong>und</strong> Adhäsionsorgan<br />
(DUNGER 1983, 2003, BELLINGER ET AL. 1996-2005). Am 4. Abdominalsegment<br />
inseriert bei vielen Arten eine Sprunggabel oder Furca. Die Furca besteht aus dem unpaaren<br />
Manubrium sowie den paarigen Abschnitten Dens <strong>und</strong> Mucro. Sie wird in Ruhestellung<br />
durch das Tenaculum, das am 3. Abdominalsegment ansetzt, unter dem Körper<br />
festgehalten <strong>und</strong> ermöglicht den <strong>Collembolen</strong> Sprünge von bis zu 35cm Weite (DUNGER<br />
2003), was der Gruppe die deutsche Bezeichnung „Springschwänze“ eingebracht hat. Das<br />
Abdomen trägt keine Cerci.<br />
Nach der Lebensform lassen sich drei Typen von <strong>Collembolen</strong> unterscheiden (GISIN 1943,<br />
BOCKEMÜHL 1956):<br />
Die euedaphischen <strong>Collembolen</strong> leben im Boden, weisen eine verringerte Körpergröße<br />
<strong>und</strong> reduzierte Köperextremitäten auf <strong>und</strong> sind oft farblos <strong>und</strong> blind. Die Sprunggabel ist<br />
zurückgebildet oder fehlt. Auch Behaarung <strong>und</strong> Schuppen fehlen weitgehend.<br />
Die epedaphischen Arten leben auf der Erdoberfläche <strong>und</strong> besiedeln die Krautschicht. Sie<br />
sind groß, stark pigmentiert, haben eine dichte Behaarung <strong>und</strong> Schuppen. Fühler, Beine<br />
<strong>und</strong> Sprunggabel sind gut ausgebildet, ebenso die Augen.<br />
Die hemiedaphischen <strong>Collembolen</strong>arten nehmen eine mittlere Stellung ein. Sie leben in<br />
den oberen Bodenschichten.<br />
Nach einer Zusammenfassung von DUNGER (2003) sind <strong>Collembolen</strong> im Allgemeinen<br />
mikrophytophag, das heißt, sie weiden Bakterien- <strong>und</strong> Algenbeläge sowie Pilzrasen ab.<br />
Als Generalisten können sie aber auch Falllaub, totes Holz, Kotballen, Pollen, Nektar,<br />
seltener Eier <strong>und</strong> andere Tiere (<strong>Collembolen</strong>, Tardigraden, Rotatorien, Nematoden) zu sich<br />
nehmen. Echte Räuber sind allerdings selten. Sie besitzen die Fähigkeit, lange Hungerperioden<br />
zu überstehen.<br />
PETERSEN UND LUXTON (1982) gaben als mittlere Dichte in terrestrischen Ökosystemen<br />
10.000 bis 100.000 <strong>Collembolen</strong> pro m 2 an. In Wäldern sind <strong>Collembolen</strong> in Zahlen von bis<br />
zu 700.000 Individuen pro m 2 (FORSSLUND 1944, zit. nach PALISSA 1964, DUNGER 1983,<br />
BOHLEN 1990) vertreten. Auf Grünland findet man laut DUNGER (1983) 20.000 bis 50.000<br />
Individuen pro m 2 . BAUCHHENß fand 1983 auf einer Wiese im Nymphenburger Park in München<br />
23.000 <strong>Collembolen</strong> pro m 2 . Die durchschnittliche Besatzdichte auf Äckern in Bayern<br />
gibt er mit 5-7 <strong>Collembolen</strong> pro 100cm 3 an (ohne Angabe der verwendeten Probennahmetiefe).<br />
HEIMANN-DETLEFSEN (1991) fand auf einem Ackerboden in der Nähe von Wolfenbüttel<br />
durchschnittlich 23.000 Individuen pro m 2 (Probennahmetiefe 10cm). LÜBBEN (1991) stellte<br />
auf einer Braunschweiger Fläche (schluffiger Sand) Mittelwerte von 16.000 bis 60.000 Individuen<br />
pro m 2 fest (Probennahmetiefe 20cm). RÖSKE (1993) fand auf <strong>verschiedenen</strong> Ackerflächen<br />
in der Umgebung von Braunschweig 20.000 bis 110.000 Individuen/m 2 (Probennahmetiefe<br />
15cm). FROMM (1997) berichtet von 1.750-11.000 Individuen/m 2 bezogen auf nur<br />
5cm Probennahmetiefe. GEIßEN-BROICH (1992) fand auf landwirtschaftlich genutzten Flächen<br />
am Niederrhein Dichten von 2.500 bis 25.000 Tieren pro m 2 (Probennahmetiefe 25cm).<br />
11