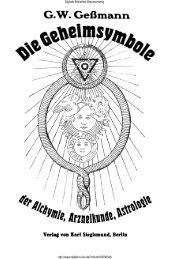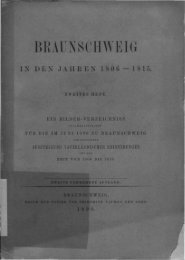Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
wenige <strong>Collembolen</strong> stimulierten den O2-Verbrauch, mehr Tiere verringerten die Atmung.<br />
Ein vergleichbares Ergebnis brachte eine Untersuchung derselben Autoren 1980 übrigens<br />
auch für Oniscus asellus <strong>und</strong> Glomeris marginata. Auch FROMM (1997) stellte bei geringem<br />
<strong>Collembolen</strong>besatz (gemischte Artenzusammensetzung) eine Atmungserhöhung, bei stärkerem<br />
Besatz eine Atmungsverminderung in Substrat mit Strohzugabe fest. BENGTSSON UND<br />
RUNDGREN (1983) stellten fest, dass die Atmungsrate von Mortierella isabellina bei Beweidung<br />
durch O.armatus abnahm, jedoch zunahm, wenn die <strong>Collembolen</strong> periodisch entfernt<br />
wurden. In einem Review kam SEASTEDT (1984) zu dem Ergebnis, dass die Atmungsraten<br />
der Mikroflora in der Gegenwart von Mikroarthropoden zunehmen, bei Überweidung allerdings<br />
abnehmen. SIEPEL (1994) stellte auch bei Oribatiden differentielle Effekte auf die Bodenatmung<br />
fest. Er führte diese auf die Mikroarthropodendichte, die Nährstoffverfügbarkeit<br />
<strong>und</strong> die Art der Beweidung zurück. Er bestätigte einen Overgrazing-Effekt bei hohen<br />
Besatzdichten. Zusätzlich hält er die Fähigkeit, Chitin zu verdauen, für entscheidend, eine<br />
Hauptkomponente der Zellwände von Pilzen. Oribatiden, die Chitin verdauen können, setzen<br />
dadurch Nährstoffe, vor allem Stickstoff, frei, welcher neues Pilzwachstum <strong>und</strong> damit<br />
die Atmungsrate fördert. Er bezeichnete die betreffenden Oribatiden als „grazers“, die anderen<br />
als „browsers“ (siehe Kapitel 6.4).<br />
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in autoklaviertem Substrat (Versuch 6;<br />
Abb. 77, 78) der Einsatz von <strong>Collembolen</strong> einen deutlich ausgeprägteren Effekt auf die<br />
Erhöhung der Bodenatmung hatte, als in nicht vorab autoklaviertem Substrat. Diese Feststellung<br />
passt auch zu der schon analysierten Erhöhung von Gesamtkeimzahl, Pilzkeimzahl<br />
<strong>und</strong> Dehydrogenaseaktivität durch Tierbesatz in autoklaviertem Substrat. Die Atmungsrate<br />
erhöhte sich in den ersten Versuchswochen nach Versuchsbeginn durch 200 F. candida in<br />
100g Substrat um ein Vielfaches. HASSALL ET AL. (1983) berichteten von demselben Phänomen:<br />
Ein <strong>Collembolen</strong>besatz auf Pappelblättern (Populus tremuloides) wirkte sich in ihrer<br />
Untersuchung nur dann erhöhend auf die Atmung aus, wenn das Substrat vorher sterilisiert<br />
worden war. Die Stimulation des Abbaus bei vorhandener mikrobieller Aktivität war in ihrer<br />
Untersuchung vernachlässigbar klein.<br />
Die Effekte des Autoklavierens sind offenbar mit den Effekten vergleichbar, die bei der Methode<br />
der Fumigation-Inkubation zur indirekten Bestimmung der mikrobiellen Biomasse<br />
genutzt werden (z.B. JENKINSON UND POWLSON 1976, KUHNERT-FINKERNAGEL 1993). Dabei<br />
wird der Boden zur Abtötung der Mikroorganismen mit Chloroform begast. Anschließend<br />
bauen Organismen eines zugesetzten Inokulums während einer zehntägigen Inkubation die<br />
abgetöteten Organismen ab. Dies führt zu einem Anstieg der CO2-Freisetzung (“flush of<br />
decomposition“), welcher zur Quantifizierung des Biomasse-Kohlenstoffs herangezogen<br />
wird. In der vorliegenden Untersuchung erfolgte die Abtötung der Bodenorganismen durch<br />
das Autoklavieren, die Zugabe des Inokulums offenbar durch die <strong>Collembolen</strong>. Die über die<br />
Tiere eingeschleppten Mikroorganismen nutzten die Nährstoffe der abgetöteten Organismen<br />
<strong>und</strong> führten so zu einer erhöhten Atmungsrate. Noch 60 Tage nach Versuchsbeginn, bei der<br />
ersten Bestimmung der Atmungsrate, war ein deutlicher Effekt in diesem Sinne erkennbar,<br />
der mit zunehmender Versuchsdauer dann abnahm. Die Atmungsrate des Bodens ohne<br />
<strong>Collembolen</strong> lag 60 Tage nach Versuchsbeginn bei 0,06mg CO2 pro St<strong>und</strong>e pro 100g<br />
Substrat, mit <strong>Collembolen</strong> bei 0,25mg CO2 pro St<strong>und</strong>e pro 100g Substrat. Die<br />
<strong>Collembolen</strong>zahl bei Versuchsbeginn lag bei 200 Tieren, bei Versuchsabschluss bei durchschnittlich<br />
45 Tieren in 100g Substrat. Die Atmung pro F. candida-Individuum wurde mit<br />
0,097µg berechnet. Es ist möglich, dass die <strong>Collembolen</strong>-Individuenzahl im Versuchsverlauf<br />
einen Peak erreicht hatte, der über der Besatzzahl von 200 lag. Dennoch ist offensichtlich,<br />
dass der direkte Anteil der <strong>Collembolen</strong> an der Gesamtatmung geringer war, als die Erhöhung<br />
der Atmungsrate durch die eingesetzten <strong>Collembolen</strong>. Die Tiere haben also offensichtlich<br />
indirekt die Atmungsrate erhöht, vermutlich durch Förderung der Mikroorganismen,<br />
was sich auch in der erhöhten Gesamtkeimzahl <strong>und</strong> Dehydrogenaseaktivität widerspiegelt.<br />
Etwas anders sieht der Vergleich nach 102 Tagen aus. Bei Versuchsabschluss lag die<br />
120