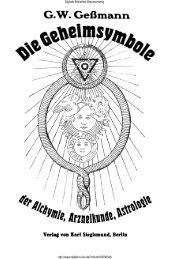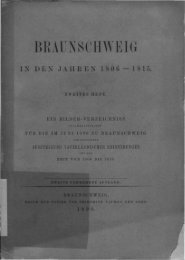Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
Atmungsrate in der Variante ohne Tiere nur noch bei 0,011mg CO2 pro St<strong>und</strong>e pro 100g<br />
Substrat. Mit Tieren lag sie bei 0,017mg CO2 pro St<strong>und</strong>e pro 100g Substrat. 45 Tiere geben<br />
ca. 4µg CO2 ab, was die Differenz fast erklärt. Die Mikroorganismenaktivität war demnach in<br />
vorher autoklaviertem Substrat nach 102 Tagen in den Varianten mit <strong>Collembolen</strong> gegenüber<br />
den tierfreien Varianten kaum noch erhöht.<br />
Der Verlauf der Atmungskurve (Abb. 77) lässt vermuten, dass die durch das Autoklavieren<br />
verfügbar gemachten Nährstoffe beim Versuchsabschluss nach 102 Tagen nicht länger zur<br />
Verfügung standen. Es haben sich neue Populationen von Bakterien <strong>und</strong> Pilzen entwickelt<br />
<strong>und</strong> ein deutlich höheres Niveau erreicht, als in der nicht autoklavierten Variante, wie man<br />
aus den Keimzahl-Graphiken ablesen kann (Abb. 4, 22). Die Bestimmung der Atmungsraten<br />
ergab allerdings niedrigere Werte als in den nicht vorab autoklavierten Varianten. Die Tierzahlen<br />
sind im Vergleich zur Besatzzahl abgesunken, lagen aber höher als in den vorher<br />
nicht autoklavierten Varianten. Offenbar haben also die Tiere das zusätzlich zur Verfügung<br />
stehende Angebot an Pilzen <strong>und</strong>/oder Bakterien genutzt. Es lässt sich spekulieren, dass bei<br />
einer Fortführung des Versuches die Tiere die Keimzahlen durch Grazing reduziert hätten<br />
<strong>und</strong> schließlich die <strong>Collembolen</strong>-Individuenzahlen abgesunken wären, da in dem geschlossenen<br />
System nur durch wenige eventuell vorhandene autotrophe Mikroorganismen oder<br />
Algen Biomasse hätte nachgeliefert werden können.<br />
Abb. 62 <strong>und</strong> Tab. 21 zeigen, dass der Zusatz organischer Substanz in allen Fällen zu<br />
einer Erhöhung der Atmungsrate führte. Die Erhöhung war bei Versuch 4 (Abb. 75, 76),<br />
der insgesamt nur über 11 Tage fortgeführt wurde, durch den Zusatz von Luzerne sehr hoch<br />
(ca. 400% gegenüber der Variante ohne zusätzliche organische Substanz), bei Versuch 12<br />
(Abb. 81, 82), der 79 Tage dauerte, durch den Zusatz von Luzerne, Stroh oder Mais<br />
geringer. Die Erhöhung durch die organische Substanz entspricht den Untersuchungsergebnissen<br />
von NAGEL (1996), FROMM (1997) <strong>und</strong> BODE (1998). BODE (1998) stellte<br />
einen Zusammenhang <strong>zwischen</strong> organisch geb<strong>und</strong>enem Kohlenstoff, organisch geb<strong>und</strong>enem<br />
Stickstoff <strong>und</strong> der Basalatmung fest. Sie stellte auch signifikant höhere Atmungsraten<br />
in Varianten mit Mineraldüngung, mit kombinierter Mineral- <strong>und</strong> organischer Düngung sowie<br />
eine positive Beziehung der Basalatmung zur Menge an eingearbeiteten Ernterückständen<br />
fest. Sie berichtete allerdings auch, dass der Effekt der Düngung auf die Erhöhung der<br />
Atmung geringer war, als auf die Erhöhung der mikrobiellen Biomasse. Auch in der vorliegenden<br />
Untersuchung zeigte sich in Versuch 12 ein ähnliches Phänomen. So wurde durch<br />
Luzerne die Atmung um 38% erhöht, die Dehydrogenaseaktivität um 85%, die Gesamtkeimzahl<br />
aber um den Faktor 21. Durch Maisblattzugabe erhöhte sich die Atmungsrate um<br />
149%, die Dehydrogenaseaktivität um 195% die Gesamtkeimzahl dagegen um den Faktor<br />
3. Durch Strohzugabe erhöhte sich die Atmung nur um 6%, die Dehydrogenaseaktivität um<br />
200%, die Gesamtkeimzahl immerhin um den Faktor 25. BODE (1998) folgerte aus ihren<br />
Untersuchungsergebnissen, dass kleine Mikroorganismen-Populationen auf ungedüngten<br />
Flächen genauso viel atmen wie große auf gedüngten Flächen. Sie vermutete eine Stresssituation<br />
für Mikroorganismen durch geringeres Nahrungsangebot auf ungedüngten Flächen<br />
<strong>und</strong> dadurch resultierenden höheren Energiebedarf zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen.<br />
Die Ergebnisse von Versuch 4 <strong>und</strong> 12 zeigen, dass der Einfluss der Tiere auf die Atmung<br />
deutlich geringer ist als der Einfluss des Zusatzes von organischem Substrat. Einsatz von<br />
Tieren in den Varianten mit Stroh, Luzerne oder Maisblatt führte in einigen Fällen zu<br />
einer weiteren Erhöhung, in anderen Fällen zu einer Erniedrigung der Atmung. NAGEL (1996)<br />
berichtete von einer Erhöhung der CO2-Abgabe durch die Mesofauna in einem Mikrokosmos-Versuch<br />
mit Haferstroh. HANLON (1981) erklärte differenzielle Effekte der Tiere<br />
durch die Qualität der Nahrungsquellen: Umso höher die Substratqualität, desto stärker<br />
das Bakterien- <strong>und</strong> Pilzwachstum, ein Overgrazing-Effekt tritt seltener auf, es ergibt sich<br />
eine erhöhte Atmung – umso geringer die Nahrungsqualität, desto geringer das Bakterien-<br />
121