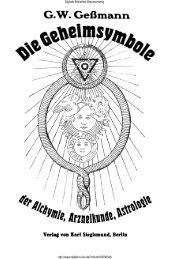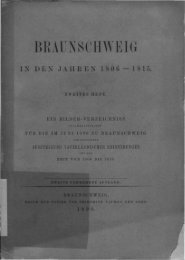Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
ohne Tierbesatz bis zu einem Maximum <strong>und</strong> fiel dann wieder deutlich ab. Durch die Tiere<br />
wurde offenbar dieser Rückgang der Gesamtkeimzahl verhindert. Möglicherweise ist dies<br />
dadurch zu erklären, dass die <strong>Collembolen</strong> durch die Beweidung eine Biostasis verhindern,<br />
Nährstoffe verfügbar <strong>und</strong> somit neues Wachstum möglich machen (z.B. HANLON UND<br />
ANDERSON 1979). In den Weckglasversuchen wurde dieser Effekt nicht in dieser Form festgestellt.<br />
Möglicherweise liegt dies an der Beimpfung der Reagenzglasversuche, die für eine<br />
bessere Nährstoffversorgung <strong>und</strong> damit höhere Überlebensrate <strong>und</strong> Reproduktion der Tiere<br />
gesorgt hat.<br />
6.4 Pilzkeimzahl<br />
Pilze sind nach SCHAEFER UND SCHINK (1994) in gut durchlüfteten Böden häufig vertreten,<br />
hauptsächlich in den oberen 10cm. Hefen bevorzugen dabei besonders feuchte Standorte.<br />
Pilze können in Ruhestadien, z.B. bei Trockenheit, überdauern, bis sich geeignete Lebensbedingungen<br />
<strong>und</strong> Nahrungsangebote einstellen. Man findet unter natürlichen Bedingungen<br />
sowohl freilebende als auch Mycorrhiza-Pilze, das heißt Pilze, die in Assoziation mit Pflanzenwurzeln<br />
vorkommen. In der vorliegenden Untersuchung wurden Pflanzenwurzeln durch<br />
Sieben weitgehend entfernt, der Themenbereich Mycorrhiza wurde nicht untersucht.<br />
Im verwendeten nicht autoklavierten Substrat waren Pilze vorhanden. Einige Versuchsansätze<br />
(Reagenzglasversuche, also Versuche I-X) wurden (z.T. nach Autoklavieren) zusätzlich<br />
mit Pilzen beimpft.<br />
Es ließ sich nur in Versuch 6 eine signifikante Korrelation <strong>zwischen</strong> dem <strong>Collembolen</strong>besatz<br />
zu Versuchsbeginn <strong>und</strong> der Pilzkeimzahl feststellen (siehe Tab. 13). Einige signifikante<br />
Unterschiede in der Pilzkeimzahl der unterschiedlichen Varianten der Reagenzglasversuche<br />
sind aus Kapitel 10.4.1 (Anhang) zu entnehmen. Unterschiedlicher Tierbesatz veränderte<br />
die Pilzkeimzahl in den Versuchen II, III (nur <strong>zwischen</strong> 20 <strong>und</strong> 50 F. candida), V, VIII (nur bei<br />
Maisblattzugabe) <strong>und</strong> IX (nur in 4-6cm Tiefe) signifikant. Die Säulendiagramme (Abb. 22-38)<br />
zeigen keinen eindeutigen Effekt des Tierbesatzes auf die Pilzkeimzahl. FABER ET AL. (1992)<br />
fanden ebenfalls keinen signifikanten Einfluss der <strong>Collembolen</strong> auf die Ab<strong>und</strong>anz der Pilze,<br />
es gab in ihrer Untersuchung offenbar nur kurzzeitige Effekte der Tiere.<br />
Bei der alleinigen Betrachtung der Weckglas- <strong>und</strong> Röhrenversuchen ohne Zugabe organischen<br />
Materials ist zu erkennen, dass die Pilzkeimzahl in diesen Versuchsansätzen<br />
durch <strong>Collembolen</strong>, insbesondere bei höheren Besatzdichten, meist vermindert worden<br />
ist (Abb. 22-28). Dieser Effekt zeigte sich offenbar vor allem bei längeren Versuchsdauern.<br />
Die Ursache ist vermutlich in dem geringen Nahrungsangebot <strong>und</strong> der im Verhältnis<br />
dazu hohen <strong>Collembolen</strong>dichte in den Versuchsansätzen zu suchen.<br />
Im Hinblick auf die möglichen fördernden <strong>und</strong> vermindernden Effekte von <strong>Collembolen</strong> auf<br />
Pilze lassen sich dieselben Mechanismen nennen, die für den Einfluss auf Bakterien in Kap.<br />
6.3 genannt wurden. Daneben sind <strong>Collembolen</strong> laut KÜHNELT (1950) auch als Nahrungskonkurrenten<br />
von Pilzen zu betrachten. Die Tiere fressen von den Bakterien freigesetzte<br />
Spaltprodukte, insbesondere beim Zelluloseabbau entstehende Zucker, <strong>und</strong> entziehen<br />
dadurch den Pilzen Nahrung.<br />
Viele Autoren haben beschrieben, dass <strong>Collembolen</strong> Pilze konsumieren. POOLE fand<br />
1959 im Darm von <strong>Collembolen</strong> einen sehr hohen Anteil an Pilzhyphen <strong>und</strong> –sporen.<br />
Daneben Cellulose, Lignin, Mineralpartikel, Thekamöben, Regenwurmborsten <strong>und</strong> <strong>Collembolen</strong>schuppen.<br />
Je kleiner die Art, desto höher war der Anteil an nicht identifizierbarem<br />
Material. Bei Arten ohne Molarplatte vermutete er flüssige Ernährung. MACBRAYER <strong>und</strong><br />
REICHLE stuften 1971 Entomobryidae <strong>und</strong> Onychiuridae als fungivor ein, Isotomidae wurden<br />
als saprophag klassifiziert. Laut ZINKLER (1971) sind <strong>Collembolen</strong> durch ihre Enzymaus-<br />
111