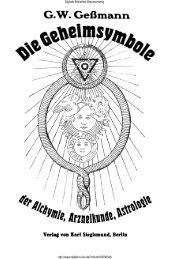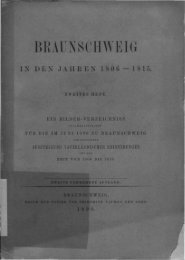Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
Der pH war durch P. minuta ab der 2. Untersuchungswoche stärker erhöht als durch F.<br />
candida. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass P. minuta mit pH 7,2 ein deutlich<br />
höheres pH-Optimum besitzt als F. candida (HUTSON 1978b). Es stellt sich die Frage, ob die<br />
Tiere, möglicherweise über die Förderung bestimmter Mikroorganismen, in der Lage<br />
sind, in bestimmten Grenzen den pH ihrer Umgebung selbst zu beeinflussen.<br />
Die Gesamtkeimzahl stieg in den Versuchsansätzen mit P. minuta eher an als bei F. candida<br />
<strong>und</strong> blieb über die gesamte Versuchsdauer von 6 Wochen deutlich höher.<br />
Die Pilzkeimzahl erreichte in der Variante mit P. minuta nach 6 Wochen einen ganz besonders<br />
hohen Wert.<br />
Die Dehydrogenaseaktivität wurde durch beide Arten an einigen Terminen erniedrigt, an<br />
anderen erhöht. Insgesamt war sie bei P. minuta-Besatz etwas niedriger als bei F. candida-<br />
Besatz.<br />
P. minuta besitzt eine geringere Körpergröße <strong>und</strong> damit geringere Biomasse als F. candida.<br />
In den Zuchten hatte es sich gezeigt, dass P. minuta eine geringere Reproduktionsrate<br />
besitzt als F. candida. Nach MASSOUD UND BETSCH-PINOT (1974) ist eine kollektive Oviposition<br />
zu beobachten. Laut HUTSON (1978b) legt ein Weibchen bei optimalem pH von 7,2<br />
durchschnittlich 42 Eier <strong>und</strong> hat eine Lebenserwartung von 143 Tagen. Das Temperaturoptimum<br />
liegt laut SPAHR (1983) bei 16 o C, also unter der hier vorgegebenen Temperatur. Es ist<br />
erstaunlich, dass trotz der für P. minuta im Vergleich zu F. candida schlechteren<br />
Lebensbedingungen, der vermutlich geringeren Reproduktion <strong>und</strong> der geringeren Biomasse,<br />
P. minuta auf die Dehydrogenaseaktivität ähnliche Effekte, auf die Gesamt- <strong>und</strong><br />
Pilzkeimzahl sowie auf den pH sogar weit stärkere Effekte ausübt als F. candida. Über eine<br />
Ursache des höheren Einflusses auf die Bakterien- <strong>und</strong> Pilzkeimzahl lässt sich nur spekulieren.<br />
Möglicherweise förderte die hemiedaphische P. minuta die Ausbreitung der Sporen<br />
durch stärkere Vertikalbewegung im Substrat stärker als die euedaphische F. candida. Versuch<br />
IX hat deutlich gezeigt, dass <strong>Collembolen</strong> in autoklaviertem Substrat für eine Ausbreitung<br />
der Mikroorganismen von oben nach unten sorgen. Vertikalwanderungen von <strong>Collembolen</strong><br />
im Boden wurden schon von HÜTHER (1961) nachgewiesen. Eventuell zeigte P.<br />
minuta eine im Vergleich zu F. candida höhere Mobilität im Substrat, da sie sich oberhalb<br />
ihres Temperaturoptimums befand <strong>und</strong> trug dadurch stärker zur Verbreitung von Sporen bei.<br />
Oder sie zeigte aus denselben Gründen eine intensivere Stoffwechselaktivität <strong>und</strong><br />
beeinflusste dadurch Bakterien <strong>und</strong> Pilze stärker als F. candida. Vielleicht gibt es auch<br />
Unterschiede in der Akzeptanz der Bodenpilze. THIELE (1989) <strong>und</strong> DRAHEIM (1992) stellten<br />
allerdings nur geringe Unterschiede im Nahrungswahlverhalten <strong>zwischen</strong> F. candida <strong>und</strong> P.<br />
minuta fest. Möglicherweise bestehen die Unterschiede auch in der Art der Beweidung.<br />
KAMPICHLER ET AL. (2004) stellten einen gegenüber F. candida geringeren Einfluss von P.<br />
minuta auf das Mycelwachstum des Basidiomyceten Hypholoma fasciculare fest.<br />
In Versuch X (Abb. 215-221) wurde der Effekt von Xenylla corticalis <strong>und</strong> Sinella coeca auf<br />
verschiedene Parameter miteinander verglichen. Signifikante Unterschiede <strong>zwischen</strong> beiden<br />
Arten ergaben sich beim pH <strong>und</strong> beim Nitratgehalt (siehe Kap. 10.4.1). Die Gesamtkeimzahl<br />
unterschied sich nicht signifikant, die zeitliche Entwicklung der Gesamtkeimzahl verlief<br />
jedoch unterschiedlich (siehe Abb. 15 oder 215): in der Variante mit Xenylla corticalis<br />
wurden eher höhere Werte erreicht, die Zahl sank dann wieder <strong>und</strong> stieg erneut an. In der<br />
Variante mit Sinella coeca stieg die Gesamtkeimzahl etwas langsamer an, erreichte aber<br />
einen höheren Maximalwert <strong>und</strong> fiel anschließend kräftiger ab. Insgesamt war der Verlauf<br />
aber ähnlich <strong>und</strong> ähnelte auch dem Verlauf der Gesamtkeimzahl im Substrat ohne Tiere.<br />
Auch Pilzkeimzahlen Abb. 33 oder 216) <strong>und</strong> Dehydrogenaseaktivität (Abb. 55 oder 217)<br />
entwickelten sich bei beiden Varianten unterschiedlich, ohne über die gesamte Dauer einen<br />
signifikanten Unterschied zu ergeben. Die Dehydrogenaseaktivität erreichte bei Einsatz von<br />
S. coeca ihr Maximum schon zu Beginn der Untersuchungsreihe, also in den ersten beiden<br />
130