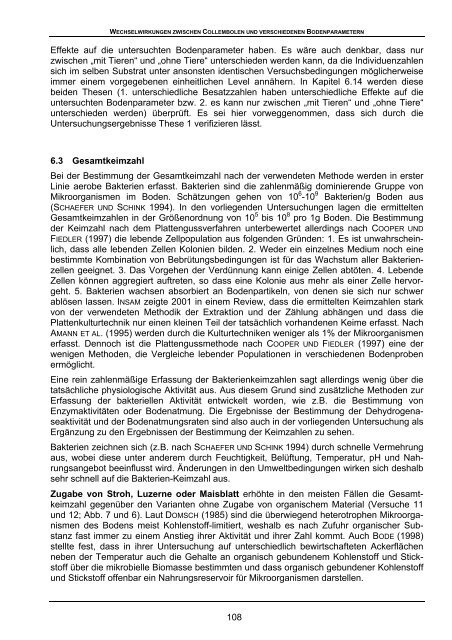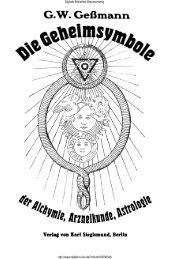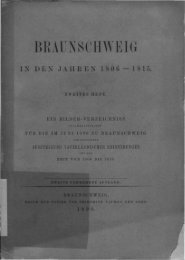Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
Effekte auf die untersuchten Bodenparameter haben. Es wäre auch denkbar, dass nur<br />
<strong>zwischen</strong> „mit Tieren“ <strong>und</strong> „ohne Tiere“ unterschieden werden kann, da die Individuenzahlen<br />
sich im selben Substrat unter ansonsten identischen Versuchsbedingungen möglicherweise<br />
immer einem vorgegebenen einheitlichen Level annähern. In Kapitel 6.14 werden diese<br />
beiden Thesen (1. unterschiedliche Besatzzahlen haben unterschiedliche Effekte auf die<br />
untersuchten Bodenparameter bzw. 2. es kann nur <strong>zwischen</strong> „mit Tieren“ <strong>und</strong> „ohne Tiere“<br />
unterschieden werden) überprüft. Es sei hier vorweggenommen, dass sich durch die<br />
Untersuchungsergebnisse These 1 verifizieren lässt.<br />
6.3 Gesamtkeimzahl<br />
Bei der Bestimmung der Gesamtkeimzahl nach der verwendeten Methode werden in erster<br />
Linie aerobe Bakterien erfasst. Bakterien sind die zahlenmäßig dominierende Gruppe von<br />
Mikroorganismen im Boden. Schätzungen gehen von 10 6 -10 9 Bakterien/g Boden aus<br />
(SCHAEFER UND SCHINK 1994). In den vorliegenden Untersuchungen lagen die ermittelten<br />
Gesamtkeimzahlen in der Größenordnung von 10 5 bis 10 8 pro 1g Boden. Die Bestimmung<br />
der Keimzahl nach dem Plattengussverfahren unterbewertet allerdings nach COOPER UND<br />
FIEDLER (1997) die lebende Zellpopulation aus folgenden Gründen: 1. Es ist unwahrscheinlich,<br />
dass alle lebenden Zellen Kolonien bilden. 2. Weder ein einzelnes Medium noch eine<br />
bestimmte Kombination von Bebrütungsbedingungen ist für das Wachstum aller Bakterienzellen<br />
geeignet. 3. Das Vorgehen der Verdünnung kann einige Zellen abtöten. 4. Lebende<br />
Zellen können aggregiert auftreten, so dass eine Kolonie aus mehr als einer Zelle hervorgeht.<br />
5. Bakterien wachsen absorbiert an Bodenpartikeln, von denen sie sich nur schwer<br />
ablösen lassen. INSAM zeigte 2001 in einem Review, dass die ermittelten Keimzahlen stark<br />
von der verwendeten Methodik der Extraktion <strong>und</strong> der Zählung abhängen <strong>und</strong> dass die<br />
Plattenkulturtechnik nur einen kleinen Teil der tatsächlich vorhandenen Keime erfasst. Nach<br />
AMANN ET AL. (1995) werden durch die Kulturtechniken weniger als 1% der Mikroorganismen<br />
erfasst. Dennoch ist die Plattengussmethode nach COOPER UND FIEDLER (1997) eine der<br />
wenigen Methoden, die Vergleiche lebender Populationen in <strong>verschiedenen</strong> Bodenproben<br />
ermöglicht.<br />
Eine rein zahlenmäßige Erfassung der Bakterienkeimzahlen sagt allerdings wenig über die<br />
tatsächliche physiologische Aktivität aus. Aus diesem Gr<strong>und</strong> sind zusätzliche Methoden zur<br />
Erfassung der bakteriellen Aktivität entwickelt worden, wie z.B. die Bestimmung von<br />
Enzymaktivitäten oder Bodenatmung. Die Ergebnisse der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivität<br />
<strong>und</strong> der Bodenatmungsraten sind also auch in der vorliegenden Untersuchung als<br />
Ergänzung zu den Ergebnissen der Bestimmung der Keimzahlen zu sehen.<br />
Bakterien zeichnen sich (z.B. nach SCHAEFER UND SCHINK 1994) durch schnelle Vermehrung<br />
aus, wobei diese unter anderem durch Feuchtigkeit, Belüftung, Temperatur, pH <strong>und</strong> Nahrungsangebot<br />
beeinflusst wird. Änderungen in den Umweltbedingungen wirken sich deshalb<br />
sehr schnell auf die Bakterien-Keimzahl aus.<br />
Zugabe von Stroh, Luzerne oder Maisblatt erhöhte in den meisten Fällen die Gesamtkeimzahl<br />
gegenüber den Varianten ohne Zugabe von organischem Material (Versuche 11<br />
<strong>und</strong> 12; Abb. 7 <strong>und</strong> 6). Laut DOMSCH (1985) sind die überwiegend heterotrophen Mikroorganismen<br />
des Bodens meist Kohlenstoff-limitiert, weshalb es nach Zufuhr organischer Substanz<br />
fast immer zu einem Anstieg ihrer Aktivität <strong>und</strong> ihrer Zahl kommt. Auch BODE (1998)<br />
stellte fest, dass in ihrer Untersuchung auf unterschiedlich bewirtschafteten Ackerflächen<br />
neben der Temperatur auch die Gehalte an organisch geb<strong>und</strong>enem Kohlenstoff <strong>und</strong> Stickstoff<br />
über die mikrobielle Biomasse bestimmten <strong>und</strong> dass organisch geb<strong>und</strong>ener Kohlenstoff<br />
<strong>und</strong> Stickstoff offenbar ein Nahrungsreservoir für Mikroorganismen darstellen.<br />
108