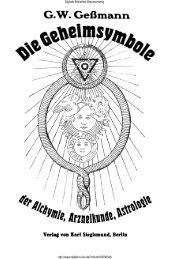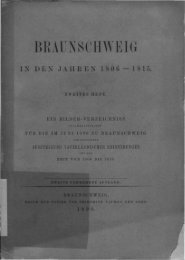Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
Phasen: Zunächst werden wasserlösliche Substanzen ausgewaschen <strong>und</strong> niedermolekulare<br />
Kohlenhydrate abgebaut. Schwerer abbaubare Substanzen (z.B. Zellulose, Lignin) müssen<br />
erst durch komplexe Enzymsysteme spezieller Mikroorganismen zerlegt werden, bevor sie<br />
aufgenommen <strong>und</strong> metabolisiert werden können (FROMM 1997).<br />
Roggenstroh (Secale cereale L.) besitzt ca. 40% Zellulose, 39% Hemizellulosen, 13% Lignin,<br />
1% Protein, 6% wasserlösliche Substanzen, 1% etherlösliche Substanzen (LYNCH<br />
1979). Die Zellwände sind verdickt, die Zellinhalte minimal, dadurch ist der Proteingehalt<br />
gering <strong>und</strong> entsprechend auch der Stickstoffanteil im Pflanzengewebe (BACON 1979). Strohzugaben<br />
erfolgten in den Versuchen 11, 12 <strong>und</strong> VIII.<br />
Maisblatt (Zea mays L. ssp. mays) enthält ca. 18% Zellulose, 31% Hemizellulosen, 19%<br />
Lignin, 5% Protein, 26% wasserlösliche Substanzen, 2% etherlösliche Substanzen (LYNCH<br />
1979). Der Proteingehalt ist deutlich höher als bei Roggenstroh. Auch der Stickstoffgehalt ist<br />
höher als bei Stroh, jedoch geringer als bei Luzerne. Nach Ergebnissen von MEBES (1999)<br />
werden Erntereste von Mais aufgr<strong>und</strong> ihres weiten C/N-Verhältnisses nur langsam abgebaut<br />
<strong>und</strong> weisen eine geringe Besiedlung durch Mikroorganismen auf, wodurch sie eine<br />
minderwertige Nahrungsquelle für <strong>Collembolen</strong> darstellen. Maisblattzugaben erfolgten in<br />
den Versuchen 11, 12 <strong>und</strong> VIII.<br />
Luzerne (Medicago sativa L., englische Bezeichnung: Alfalfa) besitzt einen Proteingehalt<br />
von ca. 20% des Frischgewichtes <strong>und</strong> dementsprechend einen hohen Stickstoffgehalt.<br />
Daneben ist Luzerne reich an leicht verfügbaren Mineralstoffen <strong>und</strong> Vitaminen. Luzerne wird<br />
zur Stickstofffixierung (Knöllchenbakterien) sowie als Futterpflanze angebaut. Luzernemehlzugaben<br />
erfolgten in den Versuchen 4, 11, 12 <strong>und</strong> VIII.<br />
Die Gesamtkeimzahl wurde durch die organischen Zusätze erhöht (siehe Versuche 11 <strong>und</strong><br />
12; Abb. 6,7). Die Abstufung dabei war in Versuch 11: Mais < Stroh < Luzerne (mit einem<br />
geringen Unterschied <strong>zwischen</strong> Mais <strong>und</strong> Stroh), in Versuch 12: Stroh < Mais < Luzerne. In<br />
Versuch VIII ((Abb. 14) zeigte sich eine entsprechende Abstufung der Gesamtkeimzahl vor<br />
allem in den tierbesetzten Ansätzen. Insgesamt hat also Luzerne eine besonders deutlich<br />
erhöhende Wirkung auf die Gesamtkeimzahl, was vermutlich mit der besonders guten<br />
Abbaubarkeit zusammenhängt.<br />
Die Abstufung der Pilzkeimzahl betrug in Versuch 11 <strong>und</strong> 12 (Abb. 24, 25): Mais < Stroh <<br />
Luzerne, in Versuch VIII (Abb. 32): Stroh < Mais < Luzerne. Auch die Pilzkeimzahl wurde<br />
also durch Luzerne am stärksten erhöht. Die Tiere erhöhen offenbar in den Luzerne-Varianten<br />
die Pilzkeimzahl zusätzlich, während sie sie in den anderen Varianten erniedrigen.<br />
Durch die erhöhte Pilzkeimzahl bei Luzernezugabe wird offenbar ein „Overgrazing“ vermieden.<br />
In Versuch VIII zeigte sich, dass die Luzerne vor allem in den ersten zwei Wochen<br />
nach Versuchsbeginn die Pilzkeimzahl deutlich gegenüber den anderen Varianten erhöhte.<br />
Dies ist vermutlich durch die leichte Verfügbarkeit der Nährstoffe zu erklären. Zu beachten<br />
war eine mögliche Wirksamkeit der in der Luzerne enthaltenen Saponine gegen manche<br />
Pilze (http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_ges<strong>und</strong>heit/bericht-3417).<br />
SONODA (1978) stellte einen lytischen Effekt von Luzerne auf Mycelien von Sclerotium rolfsii<br />
fest. In der vorliegenden Untersuchung wurde jedoch kein negativer Einfluss der Luzernezugabe<br />
auf die Pilzkeimzahl festgestellt, die Pilzkeimzahlen bei Luzernezugabe waren mindestens<br />
ebenso hoch, zum Teil sogar deutlich höher als bei Zusatz von Stroh oder Mais.<br />
Die Dehydrogenaseaktivität wurde durch die organischen Materialien deutlich erhöht<br />
(siehe Abb. 49). Die Abstufung war Luzerne < Stroh < Mais (Versuch 11; Abb. 47) bzw.<br />
Stroh < Luzerne < Mais (Versuch 12; Abb. 48), wobei der Unterschied <strong>zwischen</strong> Luzerne<br />
<strong>und</strong> Mais in Versuch 12 gering war. In Versuch VIII (Abb. 54) zeigte sich in den tierfreien<br />
Varianten eine Abstufung Stroh < Mais < Luzerne. Dabei wurde deutlich, dass in der Luzernevariante<br />
der Tierbesatz die Dehydrogenaseaktivität vor allem zu Versuchsbeginn deutlich<br />
zusätzlich erhöhte. Auch bei Maisblattzugabe wirkte der Tierbesatz stark erhöhend auf die<br />
134