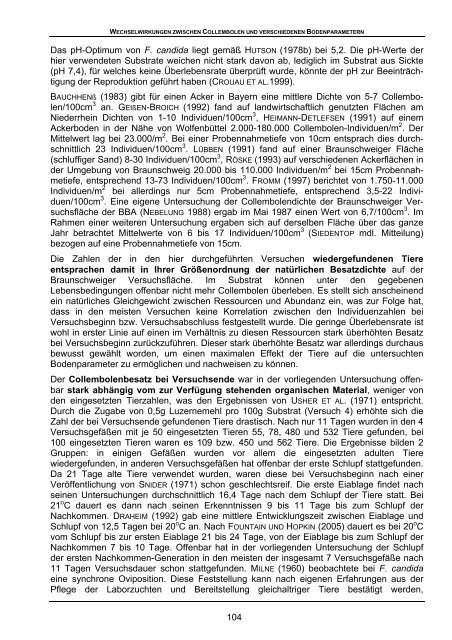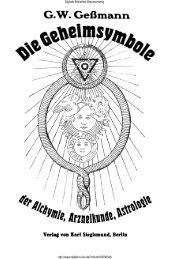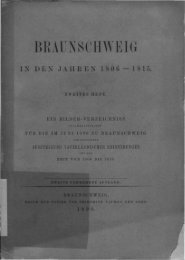Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
Das pH-Optimum von F. candida liegt gemäß HUTSON (1978b) bei 5,2. Die pH-Werte der<br />
hier verwendeten Substrate weichen nicht stark davon ab, lediglich im Substrat aus Sickte<br />
(pH 7,4), für welches keine Überlebensrate überprüft wurde, könnte der pH zur Beeinträchtigung<br />
der Reproduktion geführt haben (CROUAU ET AL.1999).<br />
BAUCHHENß (1983) gibt für einen Acker in Bayern eine mittlere Dichte von 5-7 <strong>Collembolen</strong>/100cm<br />
3 an. GEIßEN-BROICH (1992) fand auf landwirtschaftlich genutzten Flächen am<br />
Niederrhein Dichten von 1-10 Individuen/100cm 3 , HEIMANN-DETLEFSEN (1991) auf einem<br />
Ackerboden in der Nähe von Wolfenbüttel 2.000-180.000 <strong>Collembolen</strong>-Individuen/m 2 . Der<br />
Mittelwert lag bei 23.000/m 2 . Bei einer Probennahmetiefe von 10cm entsprach dies durchschnittlich<br />
23 Individuen/100cm 3 . LÜBBEN (1991) fand auf einer Braunschweiger Fläche<br />
(schluffiger Sand) 8-30 Individuen/100cm 3 , RÖSKE (1993) auf <strong>verschiedenen</strong> Ackerflächen in<br />
der Umgebung von Braunschweig 20.000 bis 110.000 Individuen/m 2 bei 15cm Probennahmetiefe,<br />
entsprechend 13-73 Individuen/100cm 3 . FROMM (1997) berichtet von 1.750-11.000<br />
Individuen/m 2 bei allerdings nur 5cm Probennahmetiefe, entsprechend 3,5-22 Individuen/100cm<br />
3 . Eine eigene Untersuchung der <strong>Collembolen</strong>dichte der Braunschweiger Versuchsfläche<br />
der BBA (NEBELUNG 1988) ergab im Mai 1987 einen Wert von 6,7/100cm 3 . Im<br />
Rahmen einer weiteren Untersuchung ergaben sich auf derselben Fläche über das ganze<br />
Jahr betrachtet Mittelwerte von 6 bis 17 Individuen/100cm 3 (SIEDENTOP mdl. Mitteilung)<br />
bezogen auf eine Probennahmetiefe von 15cm.<br />
Die Zahlen der in den hier durchgeführten Versuchen wiedergef<strong>und</strong>enen Tiere<br />
entsprachen damit in Ihrer Größenordnung der natürlichen Besatzdichte auf der<br />
Braunschweiger Versuchsfläche. Im Substrat können unter den gegebenen<br />
Lebensbedingungen offenbar nicht mehr <strong>Collembolen</strong> überleben. Es stellt sich anscheinend<br />
ein natürliches Gleichgewicht <strong>zwischen</strong> Ressourcen <strong>und</strong> Ab<strong>und</strong>anz ein, was zur Folge hat,<br />
dass in den meisten Versuchen keine Korrelation <strong>zwischen</strong> den Individuenzahlen bei<br />
Versuchsbeginn bzw. Versuchsabschluss festgestellt wurde. Die geringe Überlebensrate ist<br />
wohl in erster Linie auf einen im Verhältnis zu diesen Ressourcen stark überhöhten Besatz<br />
bei Versuchsbeginn zurückzuführen. Dieser stark überhöhte Besatz war allerdings durchaus<br />
bewusst gewählt worden, um einen maximalen Effekt der Tiere auf die untersuchten<br />
Bodenparameter zu ermöglichen <strong>und</strong> nachweisen zu können.<br />
Der <strong>Collembolen</strong>besatz bei Versuchsende war in der vorliegenden Untersuchung offenbar<br />
stark abhängig vom zur Verfügung stehenden organischen Material, weniger von<br />
den eingesetzten Tierzahlen, was den Ergebnissen von USHER ET AL. (1971) entspricht.<br />
Durch die Zugabe von 0,5g Luzernemehl pro 100g Substrat (Versuch 4) erhöhte sich die<br />
Zahl der bei Versuchsende gef<strong>und</strong>enen Tiere drastisch. Nach nur 11 Tagen wurden in den 4<br />
Versuchsgefäßen mit je 50 eingesetzten Tieren 55, 78, 480 <strong>und</strong> 532 Tiere gef<strong>und</strong>en, bei<br />
100 eingesetzten Tieren waren es 109 bzw. 450 <strong>und</strong> 562 Tiere. Die Ergebnisse bilden 2<br />
Gruppen: in einigen Gefäßen wurden vor allem die eingesetzten adulten Tiere<br />
wiedergef<strong>und</strong>en, in anderen Versuchsgefäßen hat offenbar der erste Schlupf stattgef<strong>und</strong>en.<br />
Da 21 Tage alte Tiere verwendet wurden, waren diese bei Versuchsbeginn nach einer<br />
Veröffentlichung von SNIDER (1971) schon geschlechtsreif. Die erste Eiablage findet nach<br />
seinen Untersuchungen durchschnittlich 16,4 Tage nach dem Schlupf der Tiere statt. Bei<br />
21 o C dauert es dann nach seinen Erkenntnissen 9 bis 11 Tage bis zum Schlupf der<br />
Nachkommen. DRAHEIM (1992) gab eine mittlere Entwicklungszeit <strong>zwischen</strong> Eiablage <strong>und</strong><br />
Schlupf von 12,5 Tagen bei 20 o C an. Nach FOUNTAIN UND HOPKIN (2005) dauert es bei 20 o C<br />
vom Schlupf bis zur ersten Eiablage 21 bis 24 Tage, von der Eiablage bis zum Schlupf der<br />
Nachkommen 7 bis 10 Tage. Offenbar hat in der vorliegenden Untersuchung der Schlupf<br />
der ersten Nachkommen-Generation in den meisten der insgesamt 7 Versuchsgefäße nach<br />
11 Tagen Versuchsdauer schon stattgef<strong>und</strong>en. MILNE (1960) beobachtete bei F. candida<br />
eine synchrone Oviposition. Diese Feststellung kann nach eigenen Erfahrungen aus der<br />
Pflege der Laborzuchten <strong>und</strong> Bereitstellung gleichaltriger Tiere bestätigt werden,<br />
104