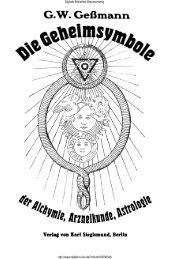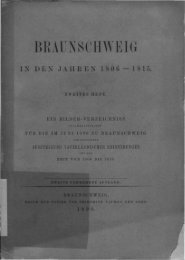Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
(hohe Reproduktionsrate, umfangreiche Erfahrungen mit Laborzuchten). Nach der Einschätzung<br />
von FOUNTAIN UND HOPKIN (2005) ist damit zu rechnen, dass F. candida noch<br />
viele weitere Jahre lang als „Standard“-Testtier eingesetzt werden wird. Sie halten F. candida<br />
für repräsentativ, da die Art weit verbreitet ist <strong>und</strong> auf die meisten Chemikalien im Vergleich<br />
mit anderen <strong>Collembolen</strong>arten relativ sensibel reagiert. Ergänzende Untersuchungen<br />
zur Funktion von F. candida im Boden, auch im Vergleich mit anderen Arten, erscheinen vor<br />
diesem Hintergr<strong>und</strong> sinnvoll.<br />
Um zu überprüfen, ob die Effekte anderer <strong>Collembolen</strong>arten im Boden mit denen von F.<br />
candida zu vergleichen sind, wurden in mehreren Versuchen auch andere Arten als Versuchstiere<br />
verwendet. Nach BEARE ET AL. (1992) weisen funktionell ähnliche Organismen<br />
häufig unterschiedliche Toleranzbereiche bezüglich bestimmter Umweltparameter sowie<br />
ihrer physiologischen Ansprüche <strong>und</strong> Mikrohabitatpräferenzen auf. Daraus lässt sich auch<br />
ableiten, dass unterschiedliche Arten im selben Habitat möglicherweise unterschiedliche<br />
Funktionen im Ökosystem erfüllen. Auch CRAGG UND BARDGETT (2001) stellten fest, dass<br />
nicht die Anzahl der Arten oder die Artendiversität entscheidend ist für Streuabbau, Förderung<br />
mikrobieller Aktivität <strong>und</strong> Freisetzung von organischem Kohlenstoff <strong>und</strong> Nitrat, sondern<br />
allein die Artenzusammensetzung der <strong>Collembolen</strong>gesellschaft. MEBES (1998) stellte Unterschiede<br />
des Einflusses verschiedener <strong>Collembolen</strong>arten auf die Nitratauswaschung fest <strong>und</strong><br />
vermutete diese auch für den Streuabbau.<br />
Nach der Klassifizierung von GISIN (1943) <strong>und</strong> BOCKEMÜHL (1956) sind F. candida <strong>und</strong> S.<br />
coeca als euedaphische, P. minuta <strong>und</strong> X. corticalis als hemiedaphische Arten einzustufen.<br />
Sowohl F. candida als auch S. coeca besitzen jedoch auch Merkmale hemiedaphischer<br />
Arten (Sprunggabel, gefiederte Borsten bei S. coeca), so dass einige Autoren F. candida<br />
dem Hemiedaphon zurechnen (z.B. HEUPEL 2002). Im Freiland sind hemiedaphische Arten<br />
mikroklimatischen Veränderungen stärker ausgesetzt als die in tieferen Bodenschichten<br />
lebenden euedaphischen Arten (HEIMANN-DETLEFSEN ET AL. 1994). Nach DUNGER (1992)<br />
reagiert deshalb das Euedaphon langsamer auf Umweltveränderungen als das Hemiedaphon.<br />
Im vorliegenden Laborversuch waren die Tiere jedoch weitgehend konstanten<br />
Umweltbedingungen ausgesetzt. Eine Ausnahme bildet die Bodenfeuchtigkeit. Die Austrocknung<br />
der Substrate während der Versuchsdauern hat möglicherweise unterschiedliche<br />
Auswirkungen auf die Arten. X. corticalis ist vermutlich die trockenheitsresistenteste der vier<br />
Arten. Dies zeigte sich in den Zuchten: X. corticalis war die einzige Art, die bei schlecht<br />
schließenden Deckeln benachbart stehende Zuchtgefäße anderer Arten besiedeln konnte.<br />
Laut FOUNTAIN UND HOPKIN (2005) ist jedoch auch F. candida außerordentlich resistent<br />
gegen Austrocknung.<br />
Xenylla corticalis wurde in Versuch 1 (Abb. 63 <strong>und</strong> 64) parallel zu Folsomia candida<br />
getestet. Im Rahmen dieses Versuches wurden lediglich Atmungsmessungen durchgeführt.<br />
Von beiden Arten wurden je 100 Individuen pro 100g Substrat eingesetzt. Beide Arten<br />
führten im Vergleich mit der tierfreien Variante zu einer signifikanten Atmungserhöhung. Der<br />
Verlauf der Atmungskurven ist sehr ähnlich (Abb. 63), die CO2-Ausstoß-Summenkurven<br />
(Abb. 64) <strong>und</strong> damit der Gesamt-CO2-Ausstoß sind fast identisch. Auch der Wilcoxon-<br />
Rangsummentest (siehe Kap. 10.4.1) zeigt keine signifikanten Unterschiede <strong>zwischen</strong><br />
Xenylla corticalis <strong>und</strong> F. candida im Hinblick auf die Atmung.<br />
In Versuch II (Abb. 71 <strong>und</strong> 72) wurden F. candida <strong>und</strong> P. minuta miteinander verglichen.<br />
Bei beiden Arten handelt es sich um Isotomiden, F. candida wird eher als euedaphisch, P.<br />
minuta als hemiedaphisch eingestuft. Zusammenfassend lassen sich <strong>zwischen</strong> den Effekten<br />
von F. candida <strong>und</strong> P. minuta eher quantitative als qualitative Unterschiede feststellen.<br />
Signifikante Unterschiede (siehe Kap. 10.4.1) ergaben sich im Hinblick auf den pH (Abb.<br />
136) <strong>und</strong> die Gesamtkeimzahl (Abb. 18). Beide Parameter wurden durch beide Tierarten<br />
fast durchgängig erhöht <strong>und</strong> zwar durch P. minuta stärker als durch F. candida.<br />
129