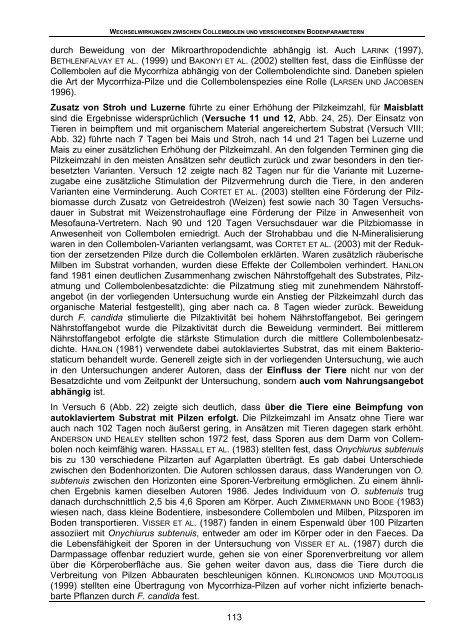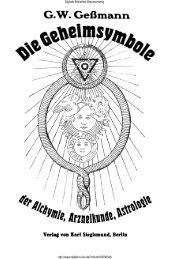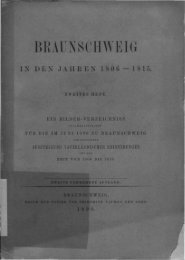Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
durch Beweidung von der Mikroarthropodendichte abhängig ist. Auch LARINK (1997),<br />
BETHLENFALVAY ET AL. (1999) <strong>und</strong> BAKONYI ET AL. (2002) stellten fest, dass die Einflüsse der<br />
<strong>Collembolen</strong> auf die Mycorrhiza abhängig von der <strong>Collembolen</strong>dichte sind. Daneben spielen<br />
die Art der Mycorrhiza-Pilze <strong>und</strong> die <strong>Collembolen</strong>spezies eine Rolle (LARSEN UND JACOBSEN<br />
1996).<br />
Zusatz von Stroh <strong>und</strong> Luzerne führte zu einer Erhöhung der Pilzkeimzahl, für Maisblatt<br />
sind die Ergebnisse widersprüchlich (Versuche 11 <strong>und</strong> 12, Abb. 24, 25). Der Einsatz von<br />
Tieren in beimpftem <strong>und</strong> mit organischem Material angereichertem Substrat (Versuch VIII;<br />
Abb. 32) führte nach 7 Tagen bei Mais <strong>und</strong> Stroh, nach 14 <strong>und</strong> 21 Tagen bei Luzerne <strong>und</strong><br />
Mais zu einer zusätzlichen Erhöhung der Pilzkeimzahl. An den folgenden Terminen ging die<br />
Pilzkeimzahl in den meisten Ansätzen sehr deutlich zurück <strong>und</strong> zwar besonders in den tierbesetzten<br />
Varianten. Versuch 12 zeigte nach 82 Tagen nur für die Variante mit Luzernezugabe<br />
eine zusätzliche Stimulation der Pilzvermehrung durch die Tiere, in den anderen<br />
Varianten eine Verminderung. Auch CORTET ET AL. (2003) stellten eine Förderung der Pilzbiomasse<br />
durch Zusatz von Getreidestroh (Weizen) fest sowie nach 30 Tagen Versuchsdauer<br />
in Substrat mit Weizenstrohauflage eine Förderung der Pilze in Anwesenheit von<br />
Mesofauna-Vertretern. Nach 90 <strong>und</strong> 120 Tagen Versuchsdauer war die Pilzbiomasse in<br />
Anwesenheit von <strong>Collembolen</strong> erniedrigt. Auch der Strohabbau <strong>und</strong> die N-Mineralisierung<br />
waren in den <strong>Collembolen</strong>-Varianten verlangsamt, was CORTET ET AL. (2003) mit der Reduktion<br />
der zersetzenden Pilze durch die <strong>Collembolen</strong> erklärten. Waren zusätzlich räuberische<br />
Milben im Substrat vorhanden, wurden diese Effekte der <strong>Collembolen</strong> verhindert. HANLON<br />
fand 1981 einen deutlichen Zusammenhang <strong>zwischen</strong> Nährstoffgehalt des Substrates, Pilzatmung<br />
<strong>und</strong> <strong>Collembolen</strong>besatzdichte: die Pilzatmung stieg mit zunehmendem Nährstoffangebot<br />
(in der vorliegenden Untersuchung wurde ein Anstieg der Pilzkeimzahl durch das<br />
organische Material festgestellt), ging aber nach ca. 8 Tagen wieder zurück. Beweidung<br />
durch F. candida stimulierte die Pilzaktivität bei hohem Nährstoffangebot. Bei geringem<br />
Nährstoffangebot wurde die Pilzaktivität durch die Beweidung vermindert. Bei mittlerem<br />
Nährstoffangebot erfolgte die stärkste Stimulation durch die mittlere <strong>Collembolen</strong>besatzdichte.<br />
HANLON (1981) verwendete dabei autoklaviertes Substrat, das mit einem Bakteriostaticum<br />
behandelt wurde. Generell zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung, wie auch<br />
in den Untersuchungen anderer Autoren, dass der Einfluss der Tiere nicht nur von der<br />
Besatzdichte <strong>und</strong> vom Zeitpunkt der Untersuchung, sondern auch vom Nahrungsangebot<br />
abhängig ist.<br />
In Versuch 6 (Abb. 22) zeigte sich deutlich, dass über die Tiere eine Beimpfung von<br />
autoklaviertem Substrat mit Pilzen erfolgt. Die Pilzkeimzahl im Ansatz ohne Tiere war<br />
auch nach 102 Tagen noch äußerst gering, in Ansätzen mit Tieren dagegen stark erhöht.<br />
ANDERSON UND HEALEY stellten schon 1972 fest, dass Sporen aus dem Darm von <strong>Collembolen</strong><br />
noch keimfähig waren. HASSALL ET AL. (1983) stellten fest, dass Onychiurus subtenuis<br />
bis zu 130 verschiedene Pilzarten auf Agarplatten überträgt. Es gab dabei Unterschiede<br />
<strong>zwischen</strong> den Bodenhorizonten. Die Autoren schlossen daraus, dass Wanderungen von O.<br />
subtenuis <strong>zwischen</strong> den Horizonten eine Sporen-Verbreitung ermöglichen. Zu einem ähnlichen<br />
Ergebnis kamen dieselben Autoren 1986. Jedes Individuum von O. subtenuis trug<br />
danach durchschnittlich 2,5 bis 4,6 Sporen am Körper. Auch ZIMMERMANN UND BODE (1983)<br />
wiesen nach, dass kleine Bodentiere, insbesondere <strong>Collembolen</strong> <strong>und</strong> Milben, Pilzsporen im<br />
Boden transportieren. VISSER ET AL. (1987) fanden in einem Espenwald über 100 Pilzarten<br />
assoziiert mit Onychiurus subtenuis, entweder am oder im Körper oder in den Faeces. Da<br />
die Lebensfähigkeit der Sporen in der Untersuchung von VISSER ET AL. (1987) durch die<br />
Darmpassage offenbar reduziert wurde, gehen sie von einer Sporenverbreitung vor allem<br />
über die Körperoberfläche aus. Sie gehen weiter davon aus, dass die Tiere durch die<br />
Verbreitung von Pilzen Abbauraten beschleunigen können. KLIRONOMOS UND MOUTOGLIS<br />
(1999) stellten eine Übertragung von Mycorrhiza-Pilzen auf vorher nicht infizierte benachbarte<br />
Pflanzen durch F. candida fest.<br />
113