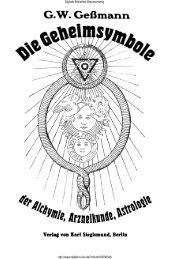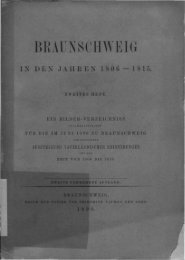Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
gewicht (z.B. BLOCK UND TILBROOK 1977) zugr<strong>und</strong>e gelegt wird. Manchmal ist unklar, ob die<br />
Werte auf Trocken- oder Feuchtgewicht bezogen sind.<br />
Manchmal fehlt auch die Angabe der Temperatur, bei der gemessen wurde (CHERNOVA ET<br />
AL. 1971). Auch der zeitliche Bezug ist uneinheitlich, die Daten werden pro St<strong>und</strong>e, pro Tag<br />
oder pro Jahr angegeben.<br />
Um die Werte besser vergleichbar zu machen, ist die Angabe aller relevanten Daten erforderlich.<br />
Der Vollständigkeit halber soll hier erwähnt werden, dass der Anteil der Tiere an den<br />
Stoffkreisläufen höher ist, als auf der Basis der reinen O2-Aufnahme oder CO2-Abgabe zu<br />
vermuten wäre. Nach DAVIS (1981) lässt sich aus dem Volumen des bei der Atmung<br />
aufgenommenen O2 mit Hilfe des Faktors 0,85 näherungsweise auf die Menge des<br />
oxidierten organischen Materials schließen. Dies sagt aber wenig über die Menge der durch<br />
die <strong>Collembolen</strong> tatsächlich aufgenommene Nahrung. DAVIS stellte folgende Gleichungen<br />
auf: Konsumption = Egestion + Assimilation <strong>und</strong> Assimilation = Produktion + Respiration.<br />
Der Anteil der Energie, der nicht über die Faeces den Körper wieder verlässt, wird zum Teil<br />
zum Aufbau körpereigener Substanzen (= Produktion) verwendet. Ein anderer Teil der<br />
Energie der aufgenommenen Nahrung wird dem Organismus durch oxidativen Abbau<br />
nutzbar gemacht (= Respiration). Sauerstoffaufnahme bzw. Kohlendioxidabgabe geben nur<br />
Aufschluss über den letzteren Anteil der aufgenommenen Energie. LUXTON (1982) stellte in<br />
einem umfangreichen Review dar, dass das Verhältnis <strong>zwischen</strong> aufgenommener<br />
Nahrungsmenge (= Konsumption) <strong>und</strong> gemessenem Sauerstoffverbrauch (= Respiration)<br />
von <strong>verschiedenen</strong> Faktoren abhängt. Auf Details soll hier nicht näher eingegangen werden.<br />
Entscheidend ist vor allem, wie energiereich die Faeces (= Egestion) sind. Dies hängt<br />
wiederum von der Menge der zur Verfügung stehenden Nahrung, von der Art der<br />
aufgenommenen Nahrung <strong>und</strong> von der Tierart ab. Nach Ergebnissen von DAVIS (1981) liegt<br />
der Anteil der Assimilation bei ca. 30% der Konsumption. Nach ENGELMANN (1966)<br />
entspricht dabei eine O2-Aufnahme von 1ml einem Energieumsatz von 20J.<br />
6.8 Bodenatmung<br />
Laut SCHNÜRER UND ROSSWALL (1982) laufen 90% des Energieflusses im Boden über die<br />
mikrobiellen Zersetzer. Sie halten deshalb die mikrobielle Aktivität für ein gutes Maß für die<br />
Umsetzung organischer Substanz. Auf der Suche nach einer sensiblen, nicht-spezifischen<br />
Meßmethode nennen Sie unter anderem Atmungsmessung <strong>und</strong> Dehydrogenaseaktivität.<br />
Auch SCHRÖDER empfahl 1980 die Bodenatmung zur Charakterisierung der Aktivität des<br />
Bodens. Nach STOTZKY (1997) ist die Messung der CO2-Abgabe der beste Parameter für die<br />
metabolische Gesamt-Aktivität einer gemischten Mikroorganismen-Population. Auch TEBBE<br />
ET AL. (2001) halten eine Untersuchung der Energieflüsse im Boden zur Bewertung<br />
ökophysiologischer <strong>und</strong> toxikologischer Fragestellungen für empfehlenswert, da sich biologische<br />
Bodenfunktionen im komplexen Wechselspiel <strong>zwischen</strong> Pflanzen, Tieren <strong>und</strong> Mikroorganismen<br />
vollziehen.<br />
Nach einem Review von SEASTEDT (1984) beträgt der Anteil der Bodenfauna an der<br />
Gesamtatmung maximal 10%. Nach FOISSNER (1987) haben in einem Boden-Ökosystem die<br />
Tiere einen Anteil von 9% an der Gesamtatmung, Bakterien <strong>und</strong> Pilze gemeinsam einen<br />
Anteil von 91%. Durch die Bestimmung der Bodenatmung, wird also in erster Linie die Aktivität<br />
der Bakterien <strong>und</strong> Pilze deutlich, wobei davon nach ANDERSON UND DOMSCH (1973) in<br />
Ackerboden der Anteil der Pilze 70%, der der Bakterien 30% beträgt.<br />
Tab. 10 zeigt deutlich die Variabilität der Atmungsraten innerhalb der <strong>verschiedenen</strong> Versuche.<br />
Aus dem Vergleich der Mittelwerte lässt sich schließen, dass bei Verwendung des<br />
118