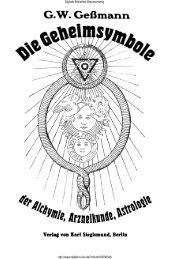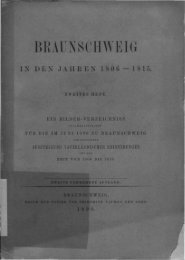Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
Werden Böden vor der Untersuchung mehrere Tage bei Raumtemperatur gelagert, wird<br />
nach DUNGER UND FIEDLER (1997) eine weitgehende Linearität der Basalatmung erreicht. Es<br />
stellt sich ein Gleichgewicht <strong>zwischen</strong> Substratangebot <strong>und</strong> Stoffwechseltätigkeit der<br />
Bodenorganismen ein. Die Basalatmungsrate (CO2-Entwicklung pro Zeiteinheit) wird von<br />
DUNGER UND FIEDLER (1997) zur Untersuchung der Einflüsse auf die Mineralisierungsgeschwindigkeit<br />
in Böden empfohlen <strong>und</strong> wurde hier zur Untersuchung der Einflüsse von<br />
<strong>Collembolen</strong> genutzt. Die Summe der gemessenen CO2-Entwicklung im Untersuchungszeitraum<br />
lässt nach DUNGER UND FIEDLER (1997) Rückschlüsse auf den Gesamt-Stoffumsatz zu.<br />
Sowohl die CO2-Entwicklung pro St<strong>und</strong>e als auch die Summe der gemessenen CO2-Entwicklung<br />
im Untersuchungszeitraum werden in Kapitel 5.6 für die Versuche 1-12 (Weckglas<strong>und</strong><br />
Röhrenversuche) graphisch dargestellt.<br />
Weckglasversuche: Kohlendioxidmessung in geschlossenen Gefäßen<br />
In den Weckgläsern wurden oberhalb des Versuchssubstrates auf einem Dreibein (gebogen<br />
aus kunststoffummanteltem Draht) flache Porzellan-Abdampfschalen (Volumen 40ml,<br />
Durchmesser 80mm, Höhe 15mm) installiert <strong>und</strong> mit 15ml NaOH-Lösung gefüllt.<br />
Röhrenversuche: Kohlendioxidmessung bei kontinuierlicher Belüftung<br />
Bei den Röhrenversuchen wurde die Luft mit Hilfe einer Pumpe über Teflonschläuche 1.<br />
durch ein wassergefülltes Reagenzglas, 2. durch die Versuchsgefäße mit dem Versuchssubstrat,<br />
3. durch ein leeres Reagenzglas, 4. durch ein weiteres Reagenzglas mit 15ml<br />
NaOH-Lösung geleitet. Durch das wassergefüllte Reagenzglas sollte die Austrocknung des<br />
Sustrates vermieden werden. Das <strong>zwischen</strong>geschaltete leere Reagenzglas sollte ein<br />
Zurückschlagen der Lauge in das Substratgefäß verhindern. Eine kontinuierliche Belüftung<br />
der Versuchsgefäße war sichergestellt, solange gleichmäßig Luftblasen durch die Lauge<br />
perlten (Sichtkontrolle).<br />
Titration<br />
Die Natronlauge wurde in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen (je nach Atmungsintensität)<br />
aus den Versuchsanordnungen entnommen <strong>und</strong> frische Lauge in die Porzellanschalen<br />
bzw. Reagenzgläser eingefüllt.<br />
Zu je 5ml NaOH aus den Versuchsanordnungen wurden 0,5ml 3N BaCl2-Lösung sowie ein<br />
Tropfen Phenolphtalein <strong>und</strong> ein Rührkern gegeben. Es wurde mit Hilfe einer automatischen<br />
Bürette mit HCl (Titrisol®, Merck) titriert. Da jeweils 15ml NaOH zur Verfügung standen,<br />
konnte die Titration für jeden parallelen Versuchsansatz jeweils zweifach durchgeführt werden.<br />
Das durch die Atmung entstandene CO2 wurde durch NaOH absorbiert. Aus dem entstandenen<br />
Na2CO3 wurde durch die Zugabe eines BaCl2-Überschusses das Carbonat als<br />
BaCO3 ausgefällt. Die Menge der nicht neutralisierten Lauge wurde durch Titration mit HCl<br />
bestimmt (siehe auch ANDERSON 1982).<br />
Nach folgender Formel kann die Menge des entstandenen CO2 bestimmt werden (STOTZKY<br />
1965):<br />
CO2 (mg)= (B-V)N*E<br />
B: Volumen des verbrauchten HCl bei Titration der Kontrolle (ml)<br />
V: Volumen des verbrauchten HCl bei Titration der Probe (ml)<br />
N: Normalität der Säure<br />
23