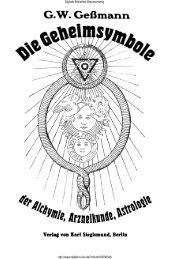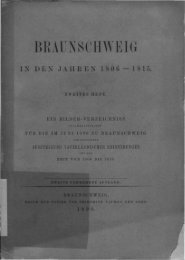Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
6.12 pH<br />
Eine Überprüfung des pH-Wertes <strong>und</strong> des Einflusses von <strong>Collembolen</strong> auf den pH erschien<br />
sinnvoll, da Untersuchungen für verschiedene Tiergruppen gezeigt haben, dass das Artenspektrum<br />
im Boden vom pH beeinflusst wird. Eine zusammenfassende Betrachtung findet<br />
sich bei LARINK UND JOSCHKO (1999). CROUAU ET AL. (1999) fanden zum Beispiel eine maximale<br />
Reproduktion von F. candida bei einem pH von 5,2. Bei einem pH-Wert von 6,9 war<br />
die Reproduktion signifikant erniedrigt. DUNGER UND FIEDLER (1997) beschrieben auch<br />
unterschiedliche pH-Präferenzen für Bakterien, Aktinomyceten <strong>und</strong> Pilze: Aktinomyceten<br />
werden in der Regel durch schwach alkalische bis neutrale, andere Bakterien durch neutrale<br />
bis schwach saure, Pilze durch schwach bis stark saure Bedingungen gefördert. HÅGVAR<br />
(1988) <strong>und</strong> BECKMANN (1990) fanden einen Zusammenhang <strong>zwischen</strong> pH <strong>und</strong><br />
Massenverlust von organischem Material: je niedriger der pH, desto geringer der<br />
Massenverlust in einem Mesokosmosversuch mit Waldboden (HÅGVAR) bzw. bei der<br />
Untersuchung verschiedener Kompostierungsverfahren (BECKMANN).<br />
Bei der Betrachtung der Reagenzglasversuche (Abb. 128-136) zeigte sich, dass die<br />
<strong>Collembolen</strong> zu einer leichten pH-Erhöhung im Versuchssubstrat führten. In den Versuchen<br />
I, II, III <strong>und</strong> V (Abb. 133-136) war die Erhöhung signifikant. Dabei handelte es sich<br />
exakt um die Versuche mit vorab autoklaviertem Substrat. Da die Tiere in autoklaviertem<br />
Substrat einen besonders deutlichen Einfluss auf die Gesamtkeimzahl hatten, wird vermutet,<br />
dass die pH-Erhöhung mit der Förderung der Bakterien einhergeht. Auch in der oben<br />
schon zitierten Untersuchung von VEDDER ET AL. (1996) war der pH unter Mitwirkung von<br />
Meso- <strong>und</strong> Makrofauna erhöht. HÅGVAR (1988) stellte ebenfalls in mehreren Mikrokosmosversuchen<br />
mit Waldboden (Rohhumus) durch <strong>Collembolen</strong>besatz (Besatzdichte 20 Tiere in<br />
2,3g Boden) nach 12 Monaten in den meisten Versuchsansätzen eine pH-Erhöhung um ca.<br />
0,1 fest. Daneben konnte er einen erhöhten Masseverlust feststellen. Er führte diesen auf<br />
direkte Einflüsse der Tiere durch Grazing oder indirekte Einflüsse zurück, wobei nach seiner<br />
Einschätzung durch den erhöhten pH möglicherweise die Bedingungen für die Mikroorganismen<br />
verbessert wurden. Nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung könnte<br />
auch umgekehrt die Erhöhung des pH durch die Förderung der Mikroorganismen hervorgerufen<br />
worden sein.<br />
Die hier beobachtete, möglicherweise durch die Förderung der Bakterien hervorgerufene,<br />
pH-Veränderung durch die <strong>Collembolen</strong> war äußerst gering, so dass damit vermutlich keine<br />
nennenswerte Auswirkung auf die Bodenbiozönose verb<strong>und</strong>en war.<br />
In den Weckglas- <strong>und</strong> Röhrenversuchen (Abb. 123-127) war kein eindeutiger Einfluss der<br />
<strong>Collembolen</strong> auf den pH erkennbar. Möglicherweise ist der Unterschied zu den Reagenzglasversuchen<br />
auf die insgesamt geringeren Gesamt- <strong>und</strong> Pilzkeimzahlen zurückzuführen.<br />
6.13 Betrachtung der <strong>Collembolen</strong>arten im Vergleich<br />
In dieser Arbeit wurden in der Mehrzahl der Versuche F. candida-Individuen als Versuchstiere<br />
eingesetzt. Streng genommen können aus diesen Versuchen also nur Erkenntnisse<br />
über Wirkungen von F. candida im Boden abgeleitet werden. Generell besteht großes<br />
Interesse an F. candida, da für F. candida ein standardisierter Toxizitätstest (ISO 1999)<br />
entwickelt wurde. Dieser findet nicht nur im Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel,<br />
sondern auch im Zusammenhang mit der Überprüfung anderer umweltrelevanter Stoffe<br />
Anwendung (CROMMENTUIJN 1994, WEFRINGHAUS 2002, SMIT 1997, HEUPEL 2002, PHILIPPS ET<br />
AL. 2004, FOUNTAIN UND HOPKIN 2001, 2004a, 2004b, siehe auch Review von FOUNTAIN UND<br />
HOPKIN 2005). Daneben gibt es eine Vielzahl von weiteren Untersuchungen zum Einfluss<br />
von Umweltchemikalien auf F. candida (z.B. BRUUS PEDERSEN 1999). Die Begründung dafür,<br />
dass gerade F. candida als Testtier verwendet wird, liegt vor allem in der guten Züchtbarkeit<br />
128