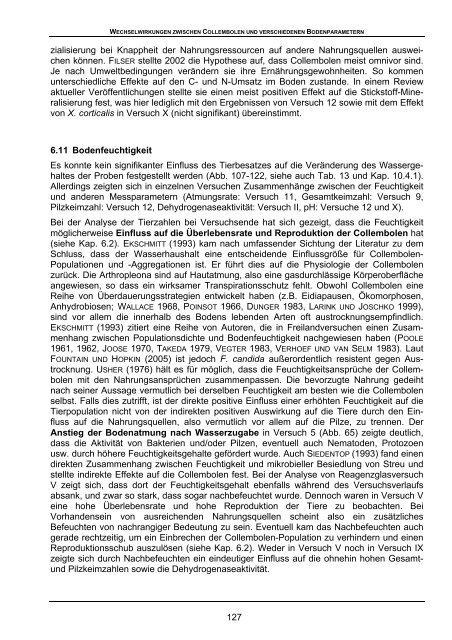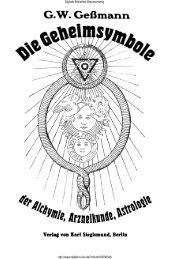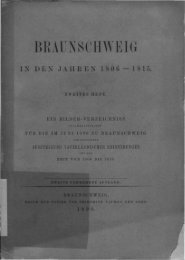Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Wechselwirkungen zwischen Collembolen und verschiedenen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN COLLEMBOLEN UND VERSCHIEDENEN BODENPARAMETERN<br />
zialisierung bei Knappheit der Nahrungsressourcen auf andere Nahrungsquellen ausweichen<br />
können. FILSER stellte 2002 die Hypothese auf, dass <strong>Collembolen</strong> meist omnivor sind.<br />
Je nach Umweltbedingungen verändern sie ihre Ernährungsgewohnheiten. So kommen<br />
unterschiedliche Effekte auf den C- <strong>und</strong> N-Umsatz im Boden zustande. In einem Review<br />
aktueller Veröffentlichungen stellte sie einen meist positiven Effekt auf die Stickstoff-Mineralisierung<br />
fest, was hier lediglich mit den Ergebnissen von Versuch 12 sowie mit dem Effekt<br />
von X. corticalis in Versuch X (nicht signifikant) übereinstimmt.<br />
6.11 Bodenfeuchtigkeit<br />
Es konnte kein signifikanter Einfluss des Tierbesatzes auf die Veränderung des Wassergehaltes<br />
der Proben festgestellt werden (Abb. 107-122, siehe auch Tab. 13 <strong>und</strong> Kap. 10.4.1).<br />
Allerdings zeigten sich in einzelnen Versuchen Zusammenhänge <strong>zwischen</strong> der Feuchtigkeit<br />
<strong>und</strong> anderen Messparametern (Atmungsrate: Versuch 11, Gesamtkeimzahl: Versuch 9,<br />
Pilzkeimzahl: Versuch 12, Dehydrogenaseaktivität: Versuch II, pH: Versuche 12 <strong>und</strong> X).<br />
Bei der Analyse der Tierzahlen bei Versuchsende hat sich gezeigt, dass die Feuchtigkeit<br />
möglicherweise Einfluss auf die Überlebensrate <strong>und</strong> Reproduktion der <strong>Collembolen</strong> hat<br />
(siehe Kap. 6.2). EKSCHMITT (1993) kam nach umfassender Sichtung der Literatur zu dem<br />
Schluss, dass der Wasserhaushalt eine entscheidende Einflussgröße für <strong>Collembolen</strong>-<br />
Populationen <strong>und</strong> -Aggregationen ist. Er führt dies auf die Physiologie der <strong>Collembolen</strong><br />
zurück. Die Arthropleona sind auf Hautatmung, also eine gasdurchlässige Körperoberfläche<br />
angewiesen, so dass ein wirksamer Transpirationsschutz fehlt. Obwohl <strong>Collembolen</strong> eine<br />
Reihe von Überdauerungsstrategien entwickelt haben (z.B. Eidiapausen, Ökomorphosen,<br />
Anhydrobiosen; WALLACE 1968, POINSOT 1966, DUNGER 1983, LARINK UND JOSCHKO 1999),<br />
sind vor allem die innerhalb des Bodens lebenden Arten oft austrocknungsempfindlich.<br />
EKSCHMITT (1993) zitiert eine Reihe von Autoren, die in Freilandversuchen einen Zusammenhang<br />
<strong>zwischen</strong> Populationsdichte <strong>und</strong> Bodenfeuchtigkeit nachgewiesen haben (POOLE<br />
1961, 1962, JOOSE 1970, TAKEDA 1979, VEGTER 1983, VERHOEF UND VAN SELM 1983). Laut<br />
FOUNTAIN UND HOPKIN (2005) ist jedoch F. candida außerordentlich resistent gegen Austrocknung.<br />
USHER (1976) hält es für möglich, dass die Feuchtigkeitsansprüche der <strong>Collembolen</strong><br />
mit den Nahrungsansprüchen zusammenpassen. Die bevorzugte Nahrung gedeiht<br />
nach seiner Aussage vermutlich bei derselben Feuchtigkeit am besten wie die <strong>Collembolen</strong><br />
selbst. Falls dies zutrifft, ist der direkte positive Einfluss einer erhöhten Feuchtigkeit auf die<br />
Tierpopulation nicht von der indirekten positiven Auswirkung auf die Tiere durch den Einfluss<br />
auf die Nahrungsquellen, also vermutlich vor allem auf die Pilze, zu trennen. Der<br />
Anstieg der Bodenatmung nach Wasserzugabe in Versuch 5 (Abb. 65) zeigte deutlich,<br />
dass die Aktivität von Bakterien <strong>und</strong>/oder Pilzen, eventuell auch Nematoden, Protozoen<br />
usw. durch höhere Feuchtigkeitsgehalte gefördert wurde. Auch SIEDENTOP (1993) fand einen<br />
direkten Zusammenhang <strong>zwischen</strong> Feuchtigkeit <strong>und</strong> mikrobieller Besiedlung von Streu <strong>und</strong><br />
stellte indirekte Effekte auf die <strong>Collembolen</strong> fest. Bei der Analyse von Reagenzglasversuch<br />
V zeigt sich, dass dort der Feuchtigkeitsgehalt ebenfalls während des Versuchsverlaufs<br />
absank, <strong>und</strong> zwar so stark, dass sogar nachbefeuchtet wurde. Dennoch waren in Versuch V<br />
eine hohe Überlebensrate <strong>und</strong> hohe Reproduktion der Tiere zu beobachten. Bei<br />
Vorhandensein von ausreichenden Nahrungsquellen scheint also ein zusätzliches<br />
Befeuchten von nachrangiger Bedeutung zu sein. Eventuell kam das Nachbefeuchten auch<br />
gerade rechtzeitig, um ein Einbrechen der <strong>Collembolen</strong>-Population zu verhindern <strong>und</strong> einen<br />
Reproduktionsschub auszulösen (siehe Kap. 6.2). Weder in Versuch V noch in Versuch IX<br />
zeigte sich durch Nachbefeuchten ein eindeutiger Einfluss auf die ohnehin hohen Gesamt-<br />
<strong>und</strong> Pilzkeimzahlen sowie die Dehydrogenaseaktivität.<br />
127