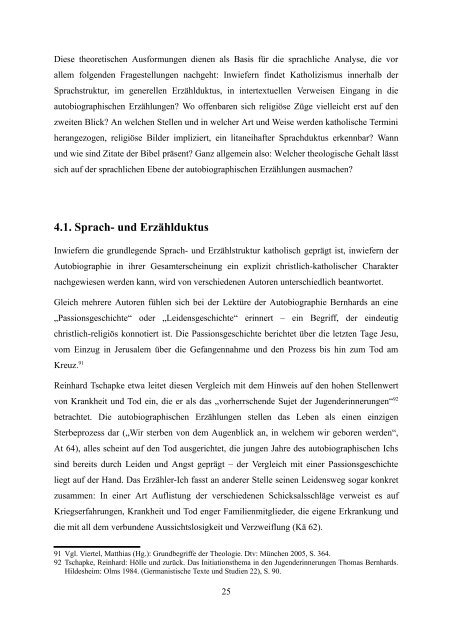DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diese theoretischen Ausformungen dienen als Basis <strong>für</strong> die sprachliche Analyse, die vor<br />
allem folgenden Fragestellungen nachgeht: Inwiefern findet Katholizismus innerhalb der<br />
Sprachstruktur, im generellen Erzählduktus, in intertextuellen Verweisen Eingang in die<br />
autobiographischen Erzählungen? Wo offenbaren sich religiöse Züge vielleicht erst auf den<br />
zweiten Blick? An welchen Stellen und in welcher Art und Weise werden katholische Termini<br />
herangezogen, religiöse Bilder impliziert, ein litaneihafter Sprachduktus erkennbar? Wann<br />
und wie sind Zitate der Bibel präsent? Ganz allgemein also: Welcher theologische Gehalt lässt<br />
sich auf der sprachlichen Ebene der autobiographischen Erzählungen ausmachen?<br />
4.1. Sprach- und Erzählduktus<br />
Inwiefern die grundlegende Sprach- und Erzählstruktur katholisch geprägt ist, inwiefern der<br />
Autobiographie in ihrer Gesamterscheinung ein explizit christlich-katholischer Charakter<br />
nachgewiesen werden kann, wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich beantwortet.<br />
Gleich mehrere Autoren fühlen sich bei der Lektüre der Autobiographie Bernhards an eine<br />
„Passionsgeschichte“ oder „Leidensgeschichte“ erinnert – ein Begriff, der eindeutig<br />
christlich-religiös konnotiert ist. Die Passionsgeschichte berichtet über die letzten Tage Jesu,<br />
vom Einzug in Jerusalem über die Gefangennahme und den Prozess bis hin zum Tod am<br />
Kreuz. 91<br />
Reinhard Tschapke etwa leitet diesen Vergleich mit dem Hinweis auf den hohen Stellenwert<br />
von Krankheit und Tod ein, die er als das „vorherrschende Sujet der Jugenderinnerungen“ 92<br />
betrachtet. Die autobiographischen Erzählungen stellen das Leben als einen einzigen<br />
Sterbeprozess dar („Wir sterben von dem Augenblick an, in welchem wir geboren werden“,<br />
At 64), alles scheint auf den Tod ausgerichtet, die jungen Jahre des autobiographischen Ichs<br />
sind bereits durch Leiden und Angst geprägt – der Vergleich mit einer Passionsgeschichte<br />
liegt auf der Hand. Das Erzähler-Ich fasst an anderer Stelle seinen Leidensweg sogar konkret<br />
zusammen: In einer Art Auflistung der verschiedenen Schicksalsschläge verweist es auf<br />
Kriegserfahrungen, Krankheit und Tod enger Familienmitglieder, die eigene Erkrankung und<br />
die mit all dem verbundene Aussichtslosigkeit und Verzweiflung (Kä 62).<br />
91 Vgl. Viertel, Matthias (Hg.): Grundbegriffe der Theologie. Dtv: München 2005, S. 364.<br />
92 Tschapke, Reinhard: Hölle und zurück. Das Initiationsthema in den Jugenderinnerungen Thomas Bernhards.<br />
Hildesheim: Olms 1984. (Germanistische Texte und Studien 22), S. 90.<br />
25