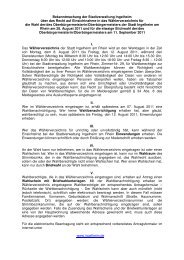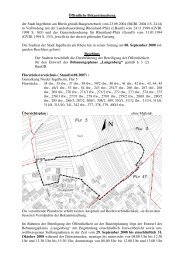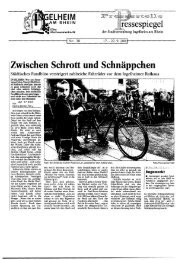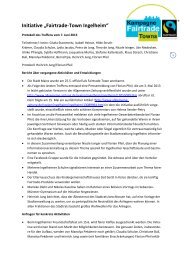Teilkonzept-Erneuerbare-Energien - Ingelheim
Teilkonzept-Erneuerbare-Energien - Ingelheim
Teilkonzept-Erneuerbare-Energien - Ingelheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Durch Geothermie erzeugter elektrischer Strom hat den Vorteil, dass seine Verfügbarkeit<br />
nicht wesentlich durch tageszeitliche oder jahreszeitliche Schwankungen beeinflusst wird und<br />
daher grundlastfähig ist. Daher ist eine Netzintegration geothermischen Stroms im Vergleich<br />
zu anderen erneuerbaren Energieträgern, wie z. B. Windkraftanlagen, wesentlich einfacher.<br />
Im Bereich der oberflächennahen Geothermie kann die Erdwärme ausschließlich zur Wärmenutzung<br />
verwendet werden.<br />
Tiefengeothermie<br />
Die Nutzung von Erdwärme aus einer Tiefe ab 400 m wird als Tiefengeothermie bezeichnet.<br />
In der Praxis spricht man jedoch erst ab einer Tiefe von 1.000 m und einer Temperatur von<br />
ca. 60 °C von tiefer Geothermie (Personenkreis Tiefe Geothermie, 2007). Innerhalb der Tiefengeothermie<br />
wird zwischen hydrothermalen und petrothermalen Systemen unterschieden.<br />
Hydrothermale Systeme nutzen wasserführende Schichten (meist Grundwasserleiter /<br />
Aquifere) in großer Tiefe und werden in der Regel als Thermalwässer bezeichnet. Thermalwasser<br />
ist laut Definition nach (Deutscher Heilbäderverband e. V., 2005, Aktualisiert 2011)<br />
Wasser, welches aus natürlichen Quellen austritt oder durch Bohrungen erschlossen wird<br />
und dessen Temperatur mehr als 20 °C beträgt.<br />
Wasservorkommen hydrothermaler Lagerstätten werden in der Regel mithilfe von mindestens<br />
zwei Bohrungen (Dublette) erschlossen. Über eine Produktionsbohrung wird das Wasser<br />
an die Erdoberfläche gefördert, an der es einer energetischen Nutzung zugeführt wird. Über<br />
eine Injektionsbohrung wird das Wasser wieder in die Tiefe zurückgeführt. Bei einer solchen<br />
Nutzungsweise besteht die Gefahr der Auskühlung des Reservoirs. Um diesen Effekt zu vermeiden,<br />
sollte der Abstand zwischen den Bohrungen zwischen ein bis zwei Kilometern betragen<br />
(Paschen, Oertel, & Grünwald, 2003).<br />
- 58 -