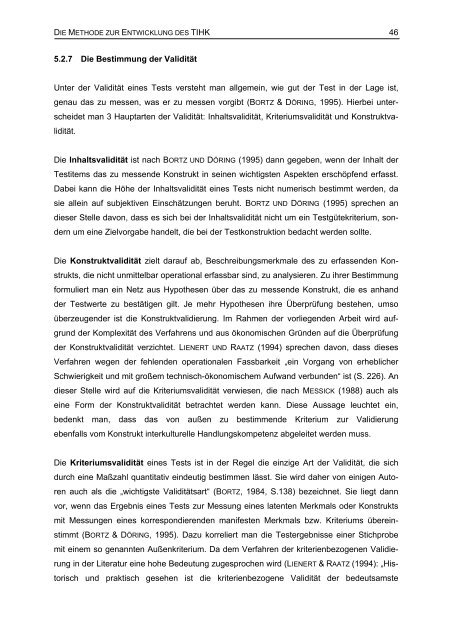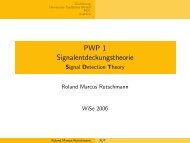Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DIE METHODE ZUR ENTWICKLUNG DES TIHK 46<br />
5.2.7 Die Bestimmung der Validität<br />
Unter der Validität <strong>eines</strong> <strong>Tests</strong> versteht man allgemein, wie gut der Test in der Lage ist,<br />
genau das zu messen, was er zu messen vorgibt (BORTZ & DÖRING, 1995). Hierbei unterscheidet<br />
man 3 Hauptarten der Validität: Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und Konstruktvalidität.<br />
Die Inhaltsvalidität ist nach BORTZ UND DÖRING (1995) dann gegeben, wenn der Inhalt der<br />
Testitems das zu messende Konstrukt in seinen wichtigsten Aspekten erschöpfend erfasst.<br />
Dabei kann die Höhe der Inhaltsvalidität <strong>eines</strong> <strong>Tests</strong> nicht numerisch bestimmt werden, da<br />
sie allein auf subjektiven Einschätzungen beruht. BORTZ UND DÖRING (1995) sprechen an<br />
dieser Stelle davon, dass es sich bei der Inhaltsvalidität nicht um ein Testgütekriterium, sondern<br />
um eine Zielvorgabe handelt, die bei der Testkonstruktion bedacht werden sollte.<br />
Die Konstruktvalidität zielt darauf ab, Beschreibungsmerkmale des zu erfassenden Konstrukts,<br />
die nicht unmittelbar operational erfassbar sind, zu analysieren. Zu ihrer Bestimmung<br />
formuliert man ein Netz aus Hypothesen über das zu messende Konstrukt, die es anhand<br />
der Testwerte zu bestätigen gilt. Je mehr Hypothesen ihre Überprüfung bestehen, umso<br />
überzeugender ist die Konstruktvalidierung. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aufgrund<br />
der Komplexität des Verfahrens und aus ökonomischen Gründen auf die Überprüfung<br />
der Konstruktvalidität verzichtet. LIENERT UND RAATZ (1994) sprechen davon, dass dieses<br />
Verfahren wegen der fehlenden operationalen Fassbarkeit „ein Vorgang von erheblicher<br />
Schwierigkeit und mit großem technisch-ökonomischem Aufwand verbunden“ ist (S. 226). An<br />
dieser Stelle wird auf die Kriteriumsvalidität verwiesen, die nach MESSICK (1988) auch als<br />
eine Form der Konstruktvalidität betrachtet werden kann. Diese Aussage leuchtet ein,<br />
bedenkt man, dass das von außen zu bestimmende Kriterium <strong>zur</strong> Validierung<br />
ebenfalls vom Konstrukt interkulturelle Handlungskompetenz abgeleitet werden muss.<br />
Die Kriteriumsvalidität <strong>eines</strong> <strong>Tests</strong> ist in der Regel die einzige Art der Validität, die sich<br />
durch eine Maßzahl quantitativ eindeutig bestimmen lässt. Sie wird daher von einigen Autoren<br />
auch als die „wichtigste Validitätsart“ (BORTZ, 1984, S.138) bezeichnet. Sie liegt dann<br />
vor, wenn das Ergebnis <strong>eines</strong> <strong>Tests</strong> <strong>zur</strong> Messung <strong>eines</strong> latenten Merkmals oder Konstrukts<br />
mit Messungen <strong>eines</strong> korrespondierenden manifesten Merkmals bzw. Kriteriums übereinstimmt<br />
(BORTZ & DÖRING, 1995). Dazu korreliert man die Testergebnisse einer Stichprobe<br />
mit einem so genannten Außenkriterium. Da dem Verfahren der kriterienbezogenen Validierung<br />
in der Literatur eine hohe Bedeutung zugesprochen wird (LIENERT & RAATZ (1994): „Historisch<br />
und praktisch gesehen ist die kriterienbezogene Validität der bedeutsamste