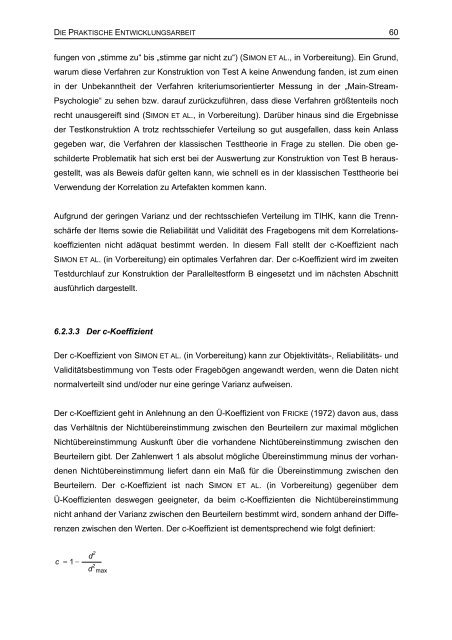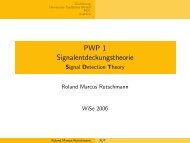Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DIE PRAKTISCHE ENTWICKLUNGSARBEIT 60<br />
fungen von „stimme zu“ bis „stimme gar nicht zu“) (SIMON ET AL., in Vorbereitung). Ein Grund,<br />
warum diese Verfahren <strong>zur</strong> Konstruktion von Test A keine Anwendung fanden, ist zum einen<br />
in der Unbekanntheit der Verfahren kriteriumsorientierter Messung in der „Main-Stream-<br />
Psychologie“ zu sehen bzw. darauf <strong>zur</strong>ückzuführen, dass diese Verfahren größtenteils noch<br />
recht unausgereift sind (SIMON ET AL., in Vorbereitung). Darüber hinaus sind die Ergebnisse<br />
der Testkonstruktion A trotz rechtsschiefer Verteilung so gut ausgefallen, dass kein Anlass<br />
gegeben war, die Verfahren der klassischen Testtheorie in Frage zu stellen. Die oben geschilderte<br />
Problematik hat sich erst bei der Auswertung <strong>zur</strong> Konstruktion von Test B herausgestellt,<br />
was als Beweis dafür gelten kann, wie schnell es in der klassischen Testtheorie bei<br />
Verwendung der Korrelation zu Artefakten kommen kann.<br />
Aufgrund der geringen Varianz und der rechtsschiefen Verteilung im TIHK, kann die Trennschärfe<br />
der Items sowie die Reliabilität und Validität des Fragebogens mit dem Korrelationskoeffizienten<br />
nicht adäquat bestimmt werden. In diesem Fall stellt der c-Koeffizient nach<br />
SIMON ET AL. (in Vorbereitung) ein optimales Verfahren dar. Der c-Koeffizient wird im zweiten<br />
Testdurchlauf <strong>zur</strong> Konstruktion der Paralleltestform B eingesetzt und im nächsten Abschnitt<br />
ausführlich dargestellt.<br />
6.2.3.3 Der c-Koeffizient<br />
Der c-Koeffizient von SIMON ET AL. (in Vorbereitung) kann <strong>zur</strong> Objektivitäts-, Reliabilitäts- und<br />
Validitätsbestimmung von <strong>Tests</strong> oder Fragebögen angewandt werden, wenn die Daten nicht<br />
normalverteilt sind und/oder nur eine geringe Varianz aufweisen.<br />
Der c-Koeffizient geht in Anlehnung an den Ü-Koeffizient von FRICKE (1972) davon aus, dass<br />
das Verhältnis der Nichtübereinstimmung zwischen den Beurteilern <strong>zur</strong> maximal möglichen<br />
Nichtübereinstimmung Auskunft über die vorhandene Nichtübereinstimmung zwischen den<br />
Beurteilern gibt. Der Zahlenwert 1 als absolut mögliche Übereinstimmung minus der vorhandenen<br />
Nichtübereinstimmung liefert dann ein Maß für die Übereinstimmung zwischen den<br />
Beurteilern. Der c-Koeffizient ist nach SIMON ET AL. (in Vorbereitung) gegenüber dem<br />
Ü-Koeffizienten deswegen geeigneter, da beim c-Koeffizienten die Nichtübereinstimmung<br />
nicht anhand der Varianz zwischen den Beurteilern bestimmt wird, sondern anhand der Differenzen<br />
zwischen den Werten. Der c-Koeffizient ist dementsprechend wie folgt definiert:<br />
c<br />
= 1 −<br />
d 2<br />
d 2<br />
max