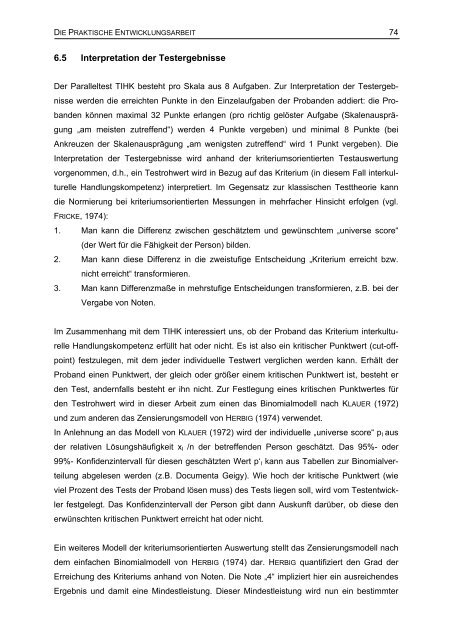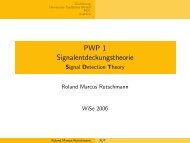Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DIE PRAKTISCHE ENTWICKLUNGSARBEIT 74<br />
6.5 Interpretation der Testergebnisse<br />
Der Paralleltest TIHK besteht pro Skala aus 8 Aufgaben. Zur Interpretation der Testergebnisse<br />
werden die erreichten Punkte in den Einzelaufgaben der Probanden addiert: die Probanden<br />
können maximal 32 Punkte erlangen (pro richtig gelöster Aufgabe (Skalenausprägung<br />
„am meisten zutreffend“) werden 4 Punkte vergeben) und minimal 8 Punkte (bei<br />
Ankreuzen der Skalenausprägung „am wenigsten zutreffend“ wird 1 Punkt vergeben). Die<br />
Interpretation der Testergebnisse wird anhand der kriteriumsorientierten Testauswertung<br />
vorgenommen, d.h., ein Testrohwert wird in Bezug auf das Kriterium (in diesem Fall interkulturelle<br />
Handlungskompetenz) interpretiert. Im Gegensatz <strong>zur</strong> klassischen Testtheorie kann<br />
die Normierung bei kriteriumsorientierten Messungen in mehrfacher Hinsicht erfolgen (vgl.<br />
FRICKE, 1974):<br />
1. Man kann die Differenz zwischen geschätztem und gewünschtem „universe score“<br />
(der Wert für die Fähigkeit der Person) bilden.<br />
2. Man kann diese Differenz in die zweistufige Entscheidung „Kriterium erreicht bzw.<br />
nicht erreicht“ transformieren.<br />
3. Man kann Differenzmaße in mehrstufige Entscheidungen transformieren, z.B. bei der<br />
Vergabe von Noten.<br />
Im Zusammenhang mit dem TIHK interessiert uns, ob der Proband das Kriterium interkulturelle<br />
Handlungskompetenz erfüllt hat oder nicht. Es ist also ein kritischer Punktwert (cut-offpoint)<br />
festzulegen, mit dem jeder individuelle Testwert verglichen werden kann. Erhält der<br />
Proband einen Punktwert, der gleich oder größer einem kritischen Punktwert ist, besteht er<br />
den Test, andernfalls besteht er ihn nicht. Zur Festlegung <strong>eines</strong> kritischen Punktwertes für<br />
den Testrohwert wird in dieser Arbeit zum einen das Binomialmodell nach KLAUER (1972)<br />
und zum anderen das Zensierungsmodell von HERBIG (1974) verwendet.<br />
In Anlehnung an das Modell von KLAUER (1972) wird der individuelle „universe score“ p I aus<br />
der relativen Lösungshäufigkeit x I /n der betreffenden Person geschätzt. Das 95%- oder<br />
99%- Konfidenzintervall für diesen geschätzten Wert p‘ I kann aus Tabellen <strong>zur</strong> Binomialverteilung<br />
abgelesen werden (z.B. Documenta Geigy). Wie hoch der kritische Punktwert (wie<br />
viel Prozent des <strong>Tests</strong> der Proband lösen muss) des <strong>Tests</strong> liegen soll, wird vom Testentwickler<br />
festgelegt. Das Konfidenzintervall der Person gibt dann Auskunft darüber, ob diese den<br />
erwünschten kritischen Punktwert erreicht hat oder nicht.<br />
Ein weiteres Modell der kriteriumsorientierten Auswertung stellt das Zensierungsmodell nach<br />
dem einfachen Binomialmodell von HERBIG (1974) dar. HERBIG quantifiziert den Grad der<br />
Erreichung des Kriteriums anhand von Noten. Die Note „4“ impliziert hier ein ausreichendes<br />
Ergebnis und damit eine Mindestleistung. Dieser Mindestleistung wird nun ein bestimmter