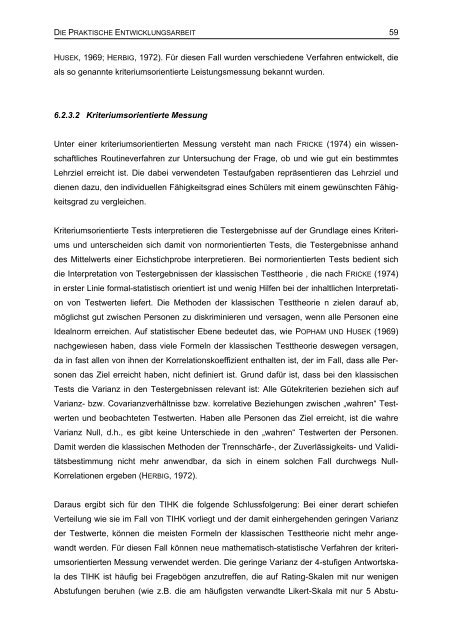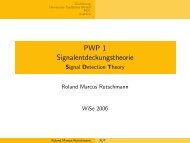Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Entwicklung eines Tests zur Erfassung interkultureller ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DIE PRAKTISCHE ENTWICKLUNGSARBEIT 59<br />
HUSEK, 1969; HERBIG, 1972). Für diesen Fall wurden verschiedene Verfahren entwickelt, die<br />
als so genannte kriteriumsorientierte Leistungsmessung bekannt wurden.<br />
6.2.3.2 Kriteriumsorientierte Messung<br />
Unter einer kriteriumsorientierten Messung versteht man nach FRICKE (1974) ein wissenschaftliches<br />
Routineverfahren <strong>zur</strong> Untersuchung der Frage, ob und wie gut ein bestimmtes<br />
Lehrziel erreicht ist. Die dabei verwendeten Testaufgaben repräsentieren das Lehrziel und<br />
dienen dazu, den individuellen Fähigkeitsgrad <strong>eines</strong> Schülers mit einem gewünschten Fähigkeitsgrad<br />
zu vergleichen.<br />
Kriteriumsorientierte <strong>Tests</strong> interpretieren die Testergebnisse auf der Grundlage <strong>eines</strong> Kriteriums<br />
und unterscheiden sich damit von normorientierten <strong>Tests</strong>, die Testergebnisse anhand<br />
des Mittelwerts einer Eichstichprobe interpretieren. Bei normorientierten <strong>Tests</strong> bedient sich<br />
die Interpretation von Testergebnissen der klassischen Testtheorie , die nach FRICKE (1974)<br />
in erster Linie formal-statistisch orientiert ist und wenig Hilfen bei der inhaltlichen Interpretation<br />
von Testwerten liefert. Die Methoden der klassischen Testtheorie n zielen darauf ab,<br />
möglichst gut zwischen Personen zu diskriminieren und versagen, wenn alle Personen eine<br />
Idealnorm erreichen. Auf statistischer Ebene bedeutet das, wie POPHAM UND HUSEK (1969)<br />
nachgewiesen haben, dass viele Formeln der klassischen Testtheorie deswegen versagen,<br />
da in fast allen von ihnen der Korrelationskoeffizient enthalten ist, der im Fall, dass alle Personen<br />
das Ziel erreicht haben, nicht definiert ist. Grund dafür ist, dass bei den klassischen<br />
<strong>Tests</strong> die Varianz in den Testergebnissen relevant ist: Alle Gütekriterien beziehen sich auf<br />
Varianz- bzw. Covarianzverhältnisse bzw. korrelative Beziehungen zwischen „wahren“ Testwerten<br />
und beobachteten Testwerten. Haben alle Personen das Ziel erreicht, ist die wahre<br />
Varianz Null, d.h., es gibt keine Unterschiede in den „wahren“ Testwerten der Personen.<br />
Damit werden die klassischen Methoden der Trennschärfe-, der Zuverlässigkeits- und Validitätsbestimmung<br />
nicht mehr anwendbar, da sich in einem solchen Fall durchwegs Null-<br />
Korrelationen ergeben (HERBIG, 1972).<br />
Daraus ergibt sich für den TIHK die folgende Schlussfolgerung: Bei einer derart schiefen<br />
Verteilung wie sie im Fall von TIHK vorliegt und der damit einhergehenden geringen Varianz<br />
der Testwerte, können die meisten Formeln der klassischen Testtheorie nicht mehr angewandt<br />
werden. Für diesen Fall können neue mathematisch-statistische Verfahren der kriteriumsorientierten<br />
Messung verwendet werden. Die geringe Varianz der 4-stufigen Antwortskala<br />
des TIHK ist häufig bei Fragebögen anzutreffen, die auf Rating-Skalen mit nur wenigen<br />
Abstufungen beruhen (wie z.B. die am häufigsten verwandte Likert-Skala mit nur 5 Abstu-