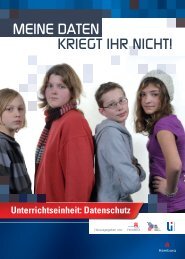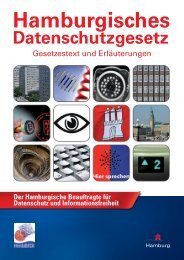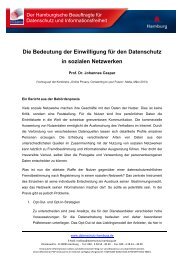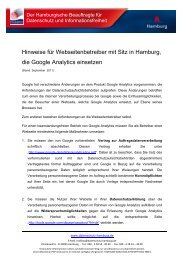21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
len Gesetzes. Dieses hat Ziel und Aufgabe der öffentlichen Stelle zu bestimmen<br />
und muss den Grundrechtseingriff im Einzelfall durch ein höherwertiges<br />
Allgemeininteresse rechtfertigen. Das bedeutet auch, dass die Eingriffe so<br />
grundrechtsfreundlich wie möglich ausfallen müssen. Die Eingriffsregelung<br />
muss verhältnismäßig sein. Zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung<br />
hat das Bun<strong>des</strong>verfassungsgericht <strong>des</strong>wegen gefordert, dass die Eingriffe<br />
in „bereichsspezifischen“ Regelungen genau umschrieben werden. Die<br />
Flut von spezialgesetzlichen Detailnormierungen – auch als „Verrechtlichungsfalle“<br />
kritisiert – hat hier ihren Ursprung.<br />
Wenn aber Aufgabe und konkrete Maßnahmen der Eingriffsverwaltung von<br />
Verfassungs wegen gesetzlich fixiert werden müssen, dann fragt sich, wo noch<br />
Spielraum bleibt für eine rechtsgeschäftliche Erklärung wie die datenschutzrechtliche<br />
Einwilligung. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Verfassung<br />
einen inhaltlichen Widerspruch zulassen will zwischen allgemeingültigen Anforderungen<br />
an das Staatshandeln zum einen und der Ausübung <strong>des</strong> Grundrechts<br />
durch den einzelnen Betroffenen zum anderen: Eine individuelle Erweiterung<br />
der hoheitlichen Befugnisse über den gesetzlich vorgegebenen<br />
Rahmen hinaus würde den grundrechtlichen Gesetzesvorbehalt aushebeln,<br />
die Gewaltenteilung und Kompetenzverteilung im Grundgesetz konterkarieren<br />
und möglicherweise auch das Gleichbehandlungsgebot verletzen.<br />
Vermisst z.B. die Polizei in der Praxis bestimmte rechtliche Handlungsmöglichkeiten<br />
zur Erfüllung ihrer Sicherheitsaufgaben, so hat sie dies an den grundrechtsgebundenen<br />
Gesetzgeber heranzutragen. Eine Einwilligung der Betroffenen<br />
in eine neue belastende hoheitliche Maßnahme kann den Gesetzesvorbehalt<br />
weder verdrängen noch ersetzen. Unmittelbar einsichtig ist dies,<br />
wenn die Polizei gegen eine Mehrzahl von Personen vorgehen müsste und will,<br />
aber hierzu keine Rechtsgrundlage hat. Die Einwilligung Einzelner kann die<br />
Polizei nicht zum Handeln gegenüber allen Personen legitimieren. Die Polizei<br />
ist aus Art.3 GG an das Gleichbehandlungsgebot gebunden. Das gilt auch für<br />
Eingriffe, die letztlich auf einer Initiative der Betroffenen selbst beruhen.<br />
Aus diesen Gründen ist das Verfahren der Zuverlässigkeitsüberprüfung im<br />
Rahmen der sogenannten Akkreditierung bei Großveranstaltungen – Fußballweltmeisterschaft,<br />
G8-Gipfel und ähnliches – nicht zulässig (unten 8.4): Dieses<br />
Verfahren sieht vor, dass Gewerbetreibende, Besucher, Aktive darin einwilligen,<br />
dass das Lan<strong>des</strong>kriminalamt und der Verfassungsschutz ihre Zuverlässigkeit<br />
überprüfen und das Ergebnis dem Veranstalter mitteilen. Spezifische<br />
gesetzliche Aufgabenzuweisungen und Datenverarbeitungsermächtigungen<br />
hierzu fehlen. Eine Ablehnung der Einwilligung hat die Verweigerung<br />
<strong>des</strong> Zutritts zur Folge – mit möglicherweise existentiellen beruflichen Konsequenzen.<br />
Freiwillig ist eine solche Einwilligung daher nicht. Damit ist sie nach<br />
§ 4 a BDSG auch nicht wirksam. Die Verantwortung für staatliches Handeln auf<br />
den Betroffenen selbst zu übertragen, ist ein untauglicher Versuch.<br />
8<br />
<strong>21.</strong> <strong>Tätigkeitsbericht</strong> 2006/2007 HmbDSB