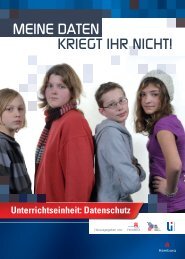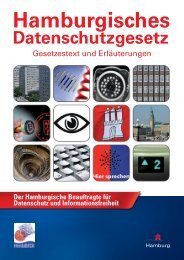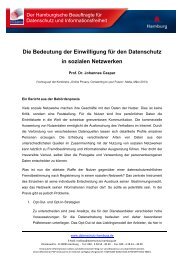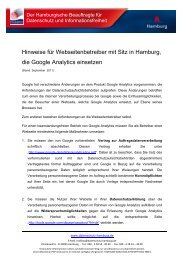21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
kann „im Notfall“ z.B. doch noch die richtige Studienakte im Prüfzentrum gefunden<br />
werden.<br />
Hiergegen hatten wir schon bei früheren Prüfungen von Studienzentren Einwände<br />
geltend gemacht und auch die Ethikkommission der Hamburger Ärztekammer<br />
überzeugen können: Wenn das Gesetz ausdrücklich eine Pseudonymisierung<br />
verlangt, so ist dies datenschutzrechtlich zu verstehen: Der Datenempfänger<br />
darf das Pseudonym nicht entschlüsseln können.<br />
Anfang 2007 fand zu diesem Thema unter unserer Leitung eine Diskussion<br />
mit dem BfArM und Datenschutzvertretern aus anderen Bun<strong>des</strong>ländern statt. Einigkeit<br />
bestand darin, dass Initialen und Geburtsdatum kein sicheres Pseudonym<br />
darstellen: Dem Übermittlungsempfänger ist es in vielen Fällen ohne großen Aufwand<br />
möglich, daraus die Identität der betroffenen Person zu ermitteln.<br />
Unabhängig von den Arzneimittelstudien führt das BfArM eine Datenbank für<br />
unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW), zu der Krankenhäuser, Ärzte,<br />
Arzneimittelhersteller und Patienten Meldungen abgeben. Das Arzneimittelgesetz<br />
verpflichtet den Inhaber einer Arzneimittelzulassung ausdrücklich zur<br />
„Anzeige“ von unerwünschten Ereignissen, schreibt aber keine Pseudonymisierung<br />
vor. Das BfArM verbreitet dazu ein Meldeformular, das das volle<br />
Geburtsdatum, die Initialen und das Geschlecht <strong>des</strong> betroffenen Patienten<br />
abfragt. Wichtig ist ihm, Doppelmeldungen zu demselben Patienten und zum<br />
selben Ereignis zu erkennen und die Schwelle für eine Meldung möglichst<br />
niedrig zu halten.<br />
In Einzelfällen will das BfArM aber auch feststellen können, ob es sich bei der<br />
Meldung eines unerwünschten Ereignisses im Rahmen einer Arzneimittelstudie<br />
um denselben Patienten handelt, zu dem auch außerhalb der Studie<br />
eine Meldung über die Nebenwirkung eines Vergleichspräparats eingegangen<br />
ist. Dazu benötige es Angaben zur Identität <strong>des</strong> Betroffenen, die beiden Meldungen<br />
gemeinsam sind. Dafür eigneten sich Geburtsdatum und Initialen. Das<br />
BfArM leitet Meldungen zu unerwünschten Ereignissen auch an die betroffenen<br />
Arzneimittelhersteller /Sponsoren weiter, die sie den früher übermittelten<br />
Probandendaten während der Arzneimittelprüfung zuordnen wollen. In beiden<br />
Fällen würde die Ergänzung <strong>des</strong> Pseudonyms jedoch die potentielle Entschlüsselung<br />
bedeuten.<br />
Zur Strukturierung und Auflösung dieser komplexen Rechtslage haben wir mit<br />
dem Lan<strong>des</strong>datenschutzbeauftragten von Hessen eine Arbeitsleitlinie entwickelt.<br />
Sie schließt die Verwendung von Initialen gänzlich aus, lässt aber bei<br />
Meldungen über unerwünschte Ereignisse außerhalb von Arzneimittelstudien<br />
die Angabe <strong>des</strong> Geburtsdatums zu. Erfordert die Praxis, dass der Sponsor /<br />
Hersteller Probandendaten aus der Arzneimittelstudie mit späteren Meldungen<br />
über Nebenwirkungen personenbezogen zusammenführt, so muss der<br />
Gesetzgeber dafür ein datenschutzgerechtes Pseudonymisierungsverfahren<br />
<strong>21.</strong> <strong>Tätigkeitsbericht</strong> 2006/2007 HmbDSB<br />
89