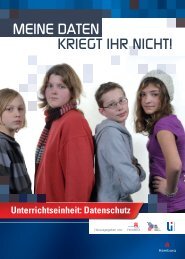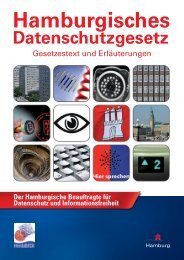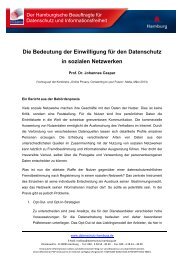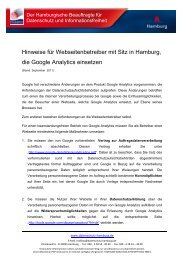21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Folgen<strong>des</strong>: Erkennt der „Case-Manager“ bei der Aufnahme eines Patienten<br />
aus den Überweisungsunterlagen, dass dieser Patient wegen einer Krebserkrankung<br />
oder eines Krebsverdachts aufzunehmen ist und dem Patienten dies<br />
bewusst ist, dann kann er den Patienten über das Krebsregister aufklären und<br />
die notwendige Einwilligung in eine mögliche Meldung bereits jetzt einholen.<br />
Der Patient wird in diesen Fällen nicht überrascht und hat sich mit der (Verdachts-)Diagnose<br />
schon auseinander gesetzt. Aufklärung und Einwilligungsbitte<br />
treffen auf ein vorbereitetes Patientenbewusstsein. Wir haben auch zugestimmt,<br />
dass die Dokumentation der Einwilligung durch einen elektronischen<br />
Eintrag im Patientendatensatz erfolgt. Sollte sich im Nachhinein ein Krebsverdacht<br />
nicht bestätigen und eine Meldung nicht Betracht kommen, ist der Einwilligungseintrag<br />
zu löschen.<br />
Fazit<br />
Insgesamt erfordert die datenschutzrechtliche Aufsicht und Beratung <strong>des</strong> UKE<br />
– zu der die Stellungnahmen zu einzelnen Forschungsprojekten noch hinzukommen<br />
– eine intensive und oft auch geduldige bis hartnäckige Betreuung.<br />
Die konstruktive Kooperation mit der betrieblichen <strong>Datenschutzbeauftragten</strong><br />
ist dabei sehr förderlich. Als Aufsichtsbehörde über den Datenschutz sehen wir<br />
allerdings mit Sorge, dass die dargestellten Entwicklungen im UKE die Kapazität<br />
einer einzelnen betrieblichen <strong>Datenschutzbeauftragten</strong> vor Ort tendenziell<br />
überfordern, zumal dann, wenn sie gedrängt wird, diese Funktion auch<br />
noch für alle Tochter-Unternehmen der UKE-Gruppe zu übernehmen.<br />
14.3 Neue Entwicklungen beim <strong>Hamburgischen</strong> Krebsregister<br />
Eine neu eingeführte Meldepflicht von Pathologen zum Krebsregister konnte<br />
datenschutzgerecht gestaltet werden; der geplante Abgleich von Mammographie-Screeningdaten<br />
mit dem Krebsregister entbehrt derzeit einer rechtlichen<br />
Grundlage.<br />
In aller Regel werden Krebsdiagnosen von Pathologen gestellt, die ihrerseits<br />
aber keinen Kontakt zu den betroffenen Patientinnen und Patienten haben und<br />
daher auch keine Meldung an das Krebsregister abgeben können, weil eine<br />
Meldung in Hamburg die Einwilligung <strong>des</strong> Patienten voraussetzt. Wenn auch<br />
die behandelnden Ärzte die Diagnosedaten dem Krebsregister nicht melden –<br />
wozu sie in Hamburg nicht verpflichtet sind -, dann gehen der epidemiologischen<br />
Forschung wichtige Daten verloren. In anderen Bun<strong>des</strong>ländern gibt es<br />
bereits eine Meldepflicht. Auch der Datenaustausch zwischen den Krebsregistern,<br />
der wegen unterschiedlicher Behandlungs- und Wohnorte der Patienten<br />
erforderlich ist, beruht inzwischen auf einem einheitlichen Standard.<br />
Im April 2007 beschloss die Bürgerschaft <strong>des</strong>wegen eine Ergänzung <strong>des</strong> <strong>Hamburgischen</strong><br />
Krebsregisters, die vorab intensiv mit uns abgestimmt wurde. Um<br />
das legitime Interesse <strong>des</strong> Krebsregisters an einer Vervollständigung seiner<br />
86<br />
<strong>21.</strong> <strong>Tätigkeitsbericht</strong> 2006/2007 HmbDSB