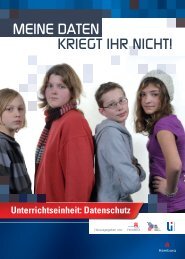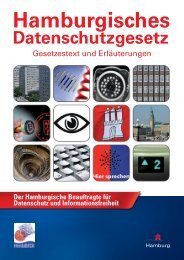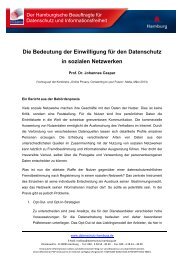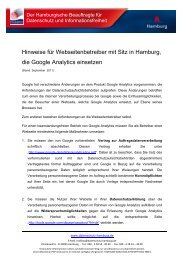21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
21. Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
stellen, ob und ggf. in welcher Höhe ein Anspruch auf die staatliche Leistung<br />
besteht. Über das Gleichbehandlungsgebot gilt dies grundsätzlich auch für<br />
Leistungen, die das Gesetz in das Ermessen der Verwaltung stellt oder die<br />
ohne eine spezielle Gesetzesgrundlage nur auf einer Haushaltsentscheidung<br />
beruhen. Die Datenoffenbarung der Betroffenen ist hier weniger eine freiwillige<br />
rechtsgeschäftliche Einwilligungserklärung als vielmehr die Wahrnehmung<br />
einer Obliegenheit oder Mitwirkungs“pflicht“, um die Antragsvoraussetzungen<br />
zu erfüllen (vgl. § 60 Sozialgesetzbuch – SGB – I). Die Selbstbestimmung liegt<br />
in der Entscheidung, einen Leistungsantrag zu stellen; die Datenoffenbarung<br />
ist die logische Folge.<br />
Auch hier bilden die gesetzlichen Vorgaben und Förderungsbedingungen<br />
einschließlich der erforderlichen Datenverarbeitung abschließende Regelungen,<br />
die nicht über individuelle Einwilligungen ausgeweitet werden dürfen. Im<br />
Bereich der massenweisen, allgemeinverbindlichen und auf Gleichbehandlung<br />
ausgerichteten Leistungsverwaltung ist – jedenfalls im Regelfall – kein Platz für<br />
individuelle Lösungen. Die Grundrechtsausübung (Einwilligung) eines Einzelnen<br />
kann die Grundrechtsausübung anderer jedenfalls nicht präjudizieren. Einzelentscheidungen<br />
der am Gleichbehandlungsgebot orientierten Leistungsverwaltung<br />
sind nicht sinnvoll und würden die Leistungsaufgabe verfehlen. So<br />
wäre eine Frage an die Leistungsempfänger, wozu sie den „zum Lebensunterhalt“<br />
erhaltenen Geldbetrag ganz konkret verwenden werden, auch dann zu<br />
kritisieren, wenn die Freiwilligkeit der Antwort außer Frage steht. Sie würde die<br />
gesetzliche Aufgabe überschreiten und wäre auch nicht repräsentativ.<br />
Die enge Zweckbindung gilt streng genommen auch für Einwilligungserklärungen<br />
in Form von Schweigepflichtentbindungen, wie sie etwa das Versorgungsamt,<br />
das Sozialamt, das Gesundheitsamt von den Antragstellern abfordern: Es<br />
geht um die Obliegenheit <strong>des</strong> Antragstellers, die zur Antragsbegründung erforderlichen<br />
Informationen beizubringen. Die Einwilligung in die direkte Kontaktaufnahme<br />
zwischen Amt und Arzt dient lediglich der Abkürzung <strong>des</strong> Kommunikationsvorgangs.<br />
Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung,<br />
an das die Leistungsverwaltung gebunden ist, gibt dem Antragsteller das<br />
Recht, die Unterlagen auch selbst bei seinen Ärzten zu beschaffen, ohne dem<br />
Amt gegenüber eine Schweigepflichtentbindung für den Arzt zu erklären. Ein<br />
unverhältnismäßiger Mehraufwand dürfte dem Amt nicht entstehen: In beiden<br />
Varianten muss es festlegen, welche medizinischen Informationen es von den<br />
Ärzten benötigt. Der Betroffene kann nicht über den erforderlichen Umfang,<br />
wohl aber über den Weg der Information frei entscheiden. Holt er die Unterlagen<br />
selbst beim Arzt ab, bleibt er auch „Herr“ der Datenoffenbarung gegenüber<br />
dem Amt.<br />
Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung hat das Bun<strong>des</strong>sozialgericht<br />
den Vorrang der gesetzlichen Regelungen vor einer Einwilligung höchstrichterlich<br />
bestätigt (19.TB 6.1): Zur Abrechnung von Krankenhauskosten um-<br />
10<br />
<strong>21.</strong> <strong>Tätigkeitsbericht</strong> 2006/2007 HmbDSB