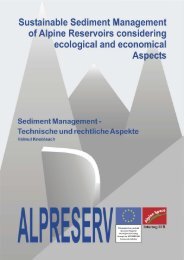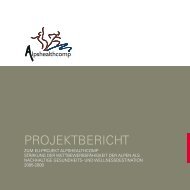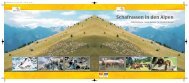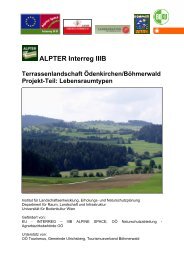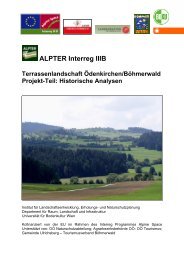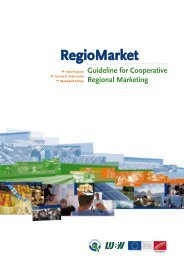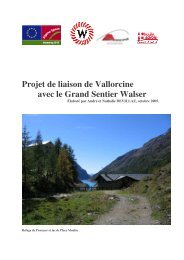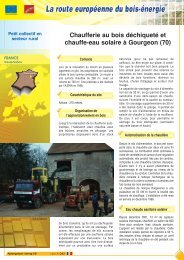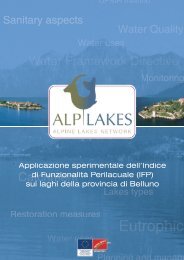WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Max Waibel<br />
üsstschabä und üss - fer apper. Ja, ja, da isch vill gsi. Zerscht si wer da unna ui ga<br />
wäägu. Hiä. Bis unner Früt. Un te der zweit Tag si wer de ga d Früt üshöwa. Ja, da<br />
deschä Wäg ga machu. Un te der drittu si wer de fa Früt inni z Cherbäch.<br />
„Auf den Weg von Frutt hinunter ins Tal gingen grosse Lawinen nieder; es waren<br />
da alles Lawinen. Und da waren zwei oder drei Männer, die den Weg markierten.<br />
Da waren ein paar Kehren zu machen. Kurze Kehren. Und diese Männer haben alles<br />
angezeichnet, damit sie mit diesen Heuburden gleiten konnten. Die waren zwei<br />
Meter lang, die Burden. Und etwa eineinhalb Meter hoch. Die Burden wogen vier<br />
Zentner. Und die Schlitten mussten um die Kehren herum kommen. Für den Weg<br />
musste, da der Schnee hoch war, an manchen Orten drei bis vier Meter tief gegraben<br />
werden. Zuerst begannen wir mit dem Wegen hier unten und legten den Weg<br />
bis unterhalb Frutt an. Und dann am zweiten Tag hoben wir die Frutt aus. Und am<br />
dritten (Tag) gingen wir von Frutt hinein nach Cherbäch.“<br />
Neben dem Heutransport bringt die Erzählung ein weiteres<br />
Brauchtumselement ins Spiel, nämlich die Gemeinschaftsarbeit. Gemeinsam<br />
legte man nach Schneefällen das nötige Wegnetz an.<br />
Lernende könnten versuchen, durch Befragung älterer Leute an ähnliche<br />
Geschichten heranzukommen. Auch solche hätten einen Platz in<br />
einer Südwalser-Chronik verdient.<br />
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass die oben zur Sprache gekommenen<br />
Erzählgattungen bei den Einheimischen stets auf Interesse stiessen,<br />
sowohl im Familienkreis als auch im Gasthaus. Deshalb, so meine<br />
ich, könnte sich der Einsatz der volkstümlichen Überlieferung im Rahmen<br />
der Revitalisierung lohnen.<br />
Wir kommen noch zum Sprichwort. Sprichwörter sind, wie Sagen und<br />
verschiedene andere Erzählgattungen auch, Wandergut. Das lässt sich<br />
leicht nachweisen. Das bereits im 19. Jahrhundert in der Schweiz aufgezeichnete<br />
Sprichwort «Der Wolf het no kein Winter gfresse» lautet nämlich<br />
in:<br />
Gressoney: De Wolf hät noch kei Wenter ggässet<br />
Macugnaga: Der Wolf hed no nii der Winter ggässet<br />
Rimella: Der Wolf het nje ggässt der Wenter<br />
Es könnte reizvoll sein, dem Vorkommen gleicher Sprichwörter bei den<br />
Südwalsern und bei den Walsern allgemein nachzugehen. Unser<br />
Sprichwort vom Wolf kommt nämlich auch in Davos vor, wo es heisst «Der<br />
Wolf hed de Winter no nie gfrässe».<br />
Und während man im Kleinwalsertal sagt Ma sött alleg dött chratza,<br />
wo s ein biist, ‘Man soll jeweils dort kratzen wo es einen juckt’, in Bosco<br />
57