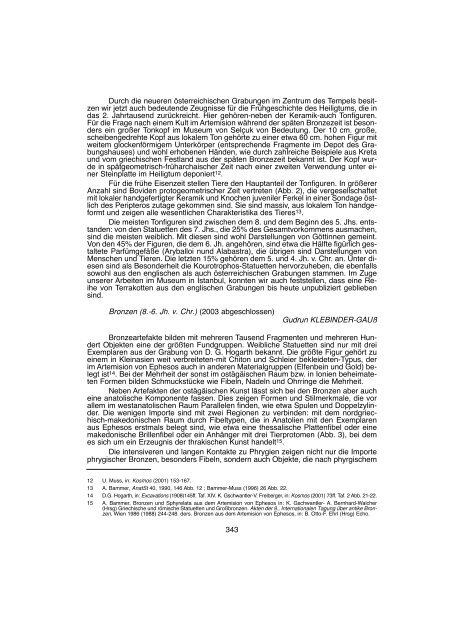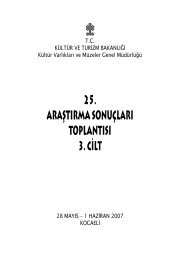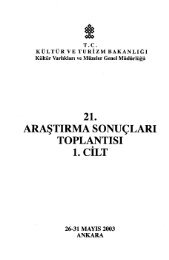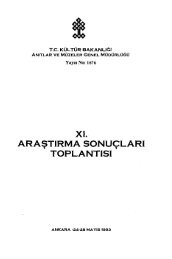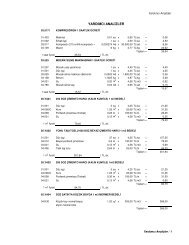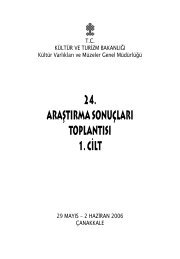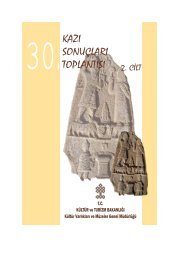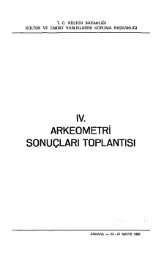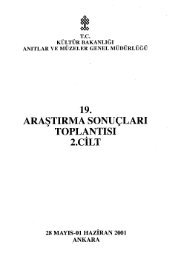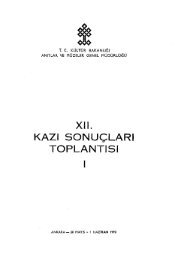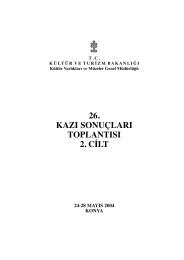--KAPAK ARAÞTIRMA kopya 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığı
--KAPAK ARAÞTIRMA kopya 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığı
--KAPAK ARAÞTIRMA kopya 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığı
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Durch die neueren österreichischen Grabungen im Zentrum des Tempels besitzen<br />
wir jetzt auch bedeutende Zeugnisse für die Frühgeschichte des Heiligtums, die in<br />
das 2. Jahrtausend zurückreicht. Hier gehören-neben der Keramik-auch Tonfiguren.<br />
Für die Frage nach einem Kult im Artemision während der späten Bronzezeit ist besonders<br />
ein großer Tonkopf im Museum von Selçuk von Bedeutung. Der 10 cm. große,<br />
scheibengedrehte Kopf aus lokalem Ton gehörte zu einer etwa 60 cm. hohen Figur mit<br />
weitem glockenförmigem Unterkörper (entsprechende Fragmente im Depot des Grabungshauses)<br />
und wohl erhobenen Händen, wie durch zahlreiche Beispiele aus Kreta<br />
und vom griechischen Festland aus der späten Bronzezeit bekannt ist. Der Kopf wurde<br />
in spätgeometrisch-früharchaischer Zeit nach einer zweiten Verwendung unter einer<br />
Steinplatte im Heiligtum deponiert 12.<br />
Für die frühe Eisenzeit stellen Tiere den Hauptanteil der Tonfiguren. In größerer<br />
Anzahl sind Boviden protogeometrischer Zeit <strong>ve</strong>rtreten (Abb. 2), die <strong>ve</strong>rgesellschaftet<br />
mit lokaler handgefertigter Keramik und Knochen ju<strong>ve</strong>niler Ferkel in einer Sondage östlich<br />
des Peripteros zutage gekommen sind. Sie sind massiv, aus lokalem Ton handgeformt<br />
und zeigen alle wesentlichen Charakteristika des Tieres 13.<br />
Die meisten Tonfiguren sind zwischen dem 8. und dem Beginn des 5. Jhs. entstanden:<br />
von den Statuetten des 7. Jhs., die 25% des Gesamtvorkommens ausmachen,<br />
sind die meisten weiblich. Mit diesen sind wohl Darstellungen von Göttinnen gemeint.<br />
Von den 45% der Figuren, die dem 6. Jh. angehören, sind etwa die Hälfte figürlich gestaltete<br />
Parfümgefäße (Aryballoi nund Alabastra), die übrigen sind Darstellungen von<br />
Menschen und Tieren. Die letzten 15% gehören dem 5. und 4. Jh. v. Chr. an. Unter diesen<br />
sind als Besonderheit die Kourotrophos-Statuetten hervorzuheben, die ebenfalls<br />
sowohl aus den englischen als auch österreichischen Grabungen stammen. Im Zuge<br />
unserer Arbeiten im Museum in İstanbul, konnten wir auch feststellen, dass eine Reihe<br />
von Terrakotten aus den englischen Grabungen bis heute unpubliziert geblieben<br />
sind.<br />
Bronzen (8.-6. Jh. v. Chr.) (2003 abgeschlossen)<br />
Gudrun KLEBINDER-GAUß<br />
Bronzeartefakte bilden mit mehreren Tausend Fragmenten und mehreren Hundert<br />
Objekten eine der größten Fundgruppen. Weibliche Statuetten sind nur mit drei<br />
Exemplaren aus der Grabung von D. G. Hogarth bekannt. Die größte Figur gehört zu<br />
einem in Kleinasien weit <strong>ve</strong>rbreiteten-mit Chiton und Schleier bekleideten-Typus, der<br />
im Artemision von Ephesos auch in anderen Materialgruppen (Elfenbein und Gold) belegt<br />
ist 14. Bei der Mehrheit der sonst im ostägäischen Raum bzw. in Ionien beheimateten<br />
Formen bilden Schmuckstücke wie Fibeln, Nadeln und Ohrringe die Mehrheit.<br />
Neben Artefakten der ostägäischen Kunst lässt sich bei den Bronzen aber auch<br />
eine anatolische Komponente fassen. Dies zeigen Formen und Stilmerkmale, die vor<br />
allem im westanatolischen Raum Parallelen finden, wie etwa Spulen und Doppelzylinder.<br />
Die wenigen Importe sind mit zwei Regionen zu <strong>ve</strong>rbinden: mit dem nordgriechisch-makedonischen<br />
Raum durch Fibeltypen, die in Anatolien mit den Exemplaren<br />
aus Ephesos erstmals belegt sind, wie etwa eine thessalische Plattenfibel oder eine<br />
makedonische Brillenfibel oder ein Anhänger mit drei Tierprotomen (Abb. 3), bei dem<br />
es sich um ein Erzeugnis der thrakischen Kunst handelt 15.<br />
Die intensi<strong>ve</strong>ren und langen Kontakte zu Phrygien zeigen nicht nur die Importe<br />
phrygischer Bronzen, besonders Fibeln, sondern auch Objekte, die nach phyrgischem<br />
12 U. Muss, in: Kosmos (2001) 153-167.<br />
13 A. Bammer, AnatSt 40, 1990, 146 Abb. 12 ; Bammer-Muss (1996) 26 Abb. 22.<br />
14 D.G. Hogarth, in: Excavations (1908)145ff. Taf. XIV. K. Gschwantler-V. Freiberger, in: Kosmos (2001) 73ff. Taf. 2 Abb. 21-22.<br />
15 A. Bammer, Bronzen und Sphyrelata aus dem Artemision von Ephesos in: K. Gschwantler- A. Bernhard-Walcher<br />
(Hrsg) Griechische und römische Statuetten und Großbronzen. Akten der 9., Internationalen Tagung über antike Bronzen,<br />
Wien 1986 (1988) 244-248. ders. Bronzen aus dem Artemision von Ephesos, in: B. Otto-F. Ehrl (Hrsg) Echo.<br />
343