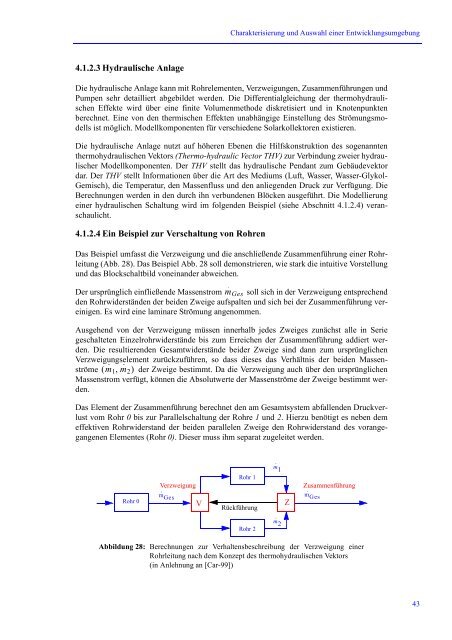Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Dokument_1.pdf (2548 KB) - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.1.2.3 Hydraulische Anlage<br />
Charakterisierung und Auswahl einer Entwicklungsumgebung<br />
Die hydraulische Anlage kann mit Rohrelementen, Verzweigungen, Zusammenführungen und<br />
Pumpen sehr detailliert abgebildet werden. Die Differentialgleichung der thermohydraulischen<br />
Effekte wird über eine finite Volumenmethode diskretisiert und in Knotenpunkten<br />
berechnet. Eine von den thermischen Effekten unabhängige Einstellung des Strömungsmodells<br />
ist möglich. Modellkomponenten für verschiedene Solarkollektoren existieren.<br />
Die hydraulische Anlage nutzt auf höheren Ebenen die Hilfskonstruktion des sogenannten<br />
thermohydraulischen Vektors (Thermo-hydraulic Vector THV) zur Verbindung zweier hydraulischer<br />
Modellkomponenten. Der THV stellt das hydraulische Pendant zum Gebäudevektor<br />
dar. Der THV stellt Informationen über die Art des Mediums (Luft, Wasser, Wasser-Glykol-<br />
Gemisch), die Temperatur, den Massenfluss und den anliegenden Druck zur Verfügung. Die<br />
Berechnungen werden in den durch ihn verbundenen Blöcken ausgeführt. Die Modellierung<br />
einer hydraulischen Schaltung wird im folgenden Beispiel (siehe Abschnitt 4.1.2.4) veranschaulicht.<br />
4.1.2.4 Ein Beispiel zur Verschaltung von Rohren<br />
Das Beispiel umfasst die Verzweigung und die anschließende Zusammenführung einer Rohrleitung<br />
(Abb. 28). Das Beispiel Abb. 28 soll demonstrieren, wie stark die intuitive Vorstellung<br />
und das Blockschaltbild voneinander abweichen.<br />
Der ursprünglich einfließende Massenstrom m soll sich in der Verzweigung entsprechend<br />
den Rohrwiderständen der beiden Zweige aufspalten und sich bei der Zusammenführung vereinigen.<br />
Es wird eine laminare Strömung angenommen.<br />
· Ges<br />
Ausgehend von der Verzweigung müssen innerhalb jedes Zweiges zunächst alle in Serie<br />
geschalteten Einzelrohrwiderstände bis zum Erreichen der Zusammenführung addiert werden.<br />
Die resultierenden Gesamtwiderstände beider Zweige sind dann zum ursprünglichen<br />
Verzweigungselement zurückzuführen, so dass dieses das Verhältnis der beiden Massen-<br />
ströme m der Zweige bestimmt. Da die Verzweigung auch über den ursprünglichen<br />
· 1 m · ( , 2)<br />
Massenstrom verfügt, können die Absolutwerte der Massenströme der Zweige bestimmt werden.<br />
Das Element der Zusammenführung berechnet den am Gesamtsystem abfallenden Druckverlust<br />
vom Rohr 0 bis zur Parallelschaltung der Rohre 1 und 2. Hierzu benötigt es neben dem<br />
effektiven Rohrwiderstand der beiden parallelen Zweige den Rohrwiderstand des vorangegangenen<br />
Elementes (Rohr 0). Dieser muss ihm separat zugeleitet werden.<br />
Rohr 0<br />
m · 1<br />
Rohr 1<br />
Verzweigung Zusammenführung<br />
m · m Ges<br />
· Ges<br />
V<br />
Rückführung<br />
Rohr 2<br />
Abbildung 28: Berechnungen zur Verhaltensbeschreibung der Verzweigung einer<br />
Rohrleitung nach dem Konzept des thermohydraulischen Vektors<br />
(in Anlehnung an [Car-99])<br />
m · 2<br />
Z<br />
43