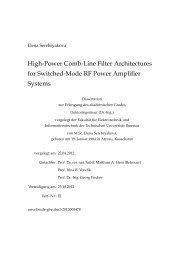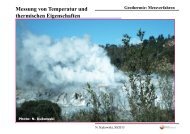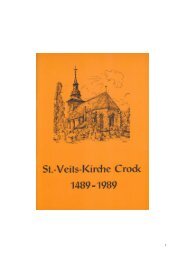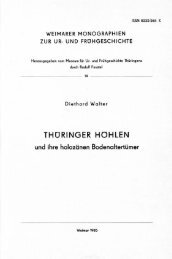Dissertation
Dissertation
Dissertation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
142<br />
eine Bewegung des Partikels quasi in Echtzeit möglich. Die Art des Gitters kann<br />
dann nachträglich über Berechnung der Fourierkoeffizienten festgelegt werden.<br />
Durch zahlreiche Versuche mit Einzelpartikeln in Form von Glaskügelchen und<br />
Chromscheiben konnte das Modell bestätigt werden. Um die Leistungsfähigkeit<br />
des Messprinzips zu beurteilen, wurde durch Messungen an definierten Partikelproben<br />
das zu erwartende Signal-Rausch-Verhältnis in Abhängigkeit des Parameters<br />
g ∗ abgeschätzt. Es zeigte sich, dass dieses mit zunehmender Partikelgröße<br />
zunächst ansteigt, um ein Maximum zu erreichen und dann wieder abzufallen.<br />
Bei der Transmissions- und Streulichtmessung ist der Verlauf anders. Hier liegt<br />
das Maximum des SNR bei kleineren Partikeldurchmessern, um von dort ausgehend<br />
zunehmender Partikelgröße exponentiell abzufallen. Für Partikel kleiner<br />
als ca. 10 µm sind die Streulichtanalyse und Transmissionsmessung der Talbotinterferometrie<br />
überlegen. Bei ansteigender Partikelgröße, Detektoren mit großem<br />
Akzeptanzwinkel und kompakter Systembauweise mit kurzen Messlängen bietet<br />
allerdings die Talbotinterferometrie Vorteile durch die Erzielung höherer Signal-<br />
Rausch-Verhältnisse. Durch Messungen mit eingeklebten Partikelproben des feinen<br />
und groben Teststaubs bei einer Messlänge von wenigen hundert Mikrometern<br />
konnte dies bestätigt werden. Der ideale Abstand zwischen Partikelposition und<br />
Detektor ist abhängig von g ∗ , liegt aber größtenteils im Bereich von einer halben<br />
bis einer ganzen Talbotlänge.<br />
Ausgehend von den theoretischen Betrachtungen erfolgte die Systemintegration.<br />
Angestrebt wurde die Entwicklung eines planar integrierten freiraumoptischen<br />
Systems, das weitestgehend auf Peripheriegeräte verzichtet und somit kompakt<br />
und transportabel ist. Beim Ansatz der planar integrierten Freiraumoptik propagiert<br />
das Licht durch ein transparentes Substrat und interagiert mit den optischen<br />
Komponente, die an der Substratgrenzfläche integriert sind. Ein Testsystem auf<br />
der Materialbasis Saphir-Galliumnitrid, das mit diffraktiven optischen Elementen<br />
zur Strahlfokussierung arbeitet, wurde demonstriert.<br />
Ein zweites System, das auf der dynamischen Messung des Streulichtes und<br />
der Transmission beruht, stellt ein integriertes optofluidisches System zur quantitativen<br />
Analyse fließender Suspensionen dar. Das System benötigt als Peripheriegeräte<br />
lediglich eine 9V-Batterie zur Spannungsversorgung und ein Multimeter<br />
zur Messung des Photostroms. Alle aktiven optischen Komponenten, also<br />
die Lichtquelle und die Detektoren, befinden sich auf einem Siliziumchip, einer<br />
sogenannten planaren Strahler-Empfänger-Baugruppen. Die planare Systemintegration<br />
erfolgte in PMMA, das mittels Ultrapräzisionsfräsen bearbeitet wurde.<br />
Das von einem VCSEL bei 850 nm emittierte Licht ist divergent und wird durch<br />
eine optische Freiformfläche abgelenkt und auf einem Zick-Zack-Pfad durch das<br />
System auf den Primärlichtdetektor geführt. Streulichtdetektoren messen das gestreute<br />
Licht. Durch die Auswertung des Mittelwerts und der Standardabweichung<br />
des Streulichtes war es möglich, die Partikelmassekonzentration zwischen