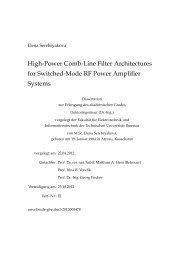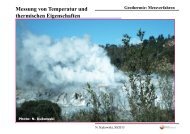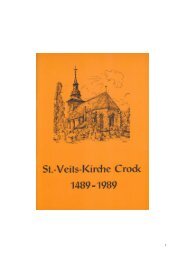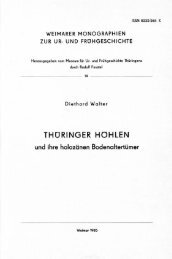Dissertation
Dissertation
Dissertation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
82 4.5. Optimierung der Messkonfiguration<br />
wegung realisiert. Für jede einzelne Ordnung erfolgt die komplexe Multiplikation<br />
und schließlich die Feldverteilung als Summe über die Ordnungen. Wegen der<br />
Skalierungseigenschaften (vgl. Kapitel 4.3.3) erfolgt eine allgemeine Betrachtung<br />
mit den Paramtern g ∗ , p und z T .<br />
Die Partikelposition fällt zunächst mit der Detektionsebene zusammen. Das<br />
Partikel bewegt sich lateral von der Position x = −6p bis zur Position +6p mit<br />
einer Schrittweite von p/50 am Detektor vorbei und die Intensität im Detektionsbereich<br />
wird für jede Position ermittelt. Dieses Signal wird für Partikel-<br />
Detektorabstände von 0 bis 10z T mit einer Schrittweite von z T /20 berechnet. Die<br />
Wellenlänge geht unmittelbar über die Talbotlänge z T = 2p 2 /λ ein und kann<br />
somit frei gewählt werden. Der Detektor hat eine Breite von p/4. Da die Intensitätsverteilung<br />
in y symmetrisch ist, wird in dieser Richtung nur eine Hälfte des<br />
Detektors ausgelesen, diese hat eine Länge von 5p.<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
(a)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
(d)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
(g)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
150<br />
100<br />
50<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
1<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
(b)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
(e)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
(h)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
1.06<br />
1.04<br />
1.02<br />
1<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
Abstand Partikel−Detektor z/z T<br />
(c)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
(f)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
(i)<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
−6 −4 −2 0 2 4 6<br />
laterale Partikelpostion x/p<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
1.01<br />
1.008<br />
1.006<br />
1.004<br />
1.002<br />
1<br />
Bild 4.33.: Intensität in Abhängigkeit der zweidimensionalen Position des Partikels<br />
für g ∗ = (a) 2,5 (b) 1,5 (c) 1 (d) 0,5 (e) 0,2 (f) 0,1 (g) 0,05 (h)<br />
0,02 (i) 0,01.<br />
Bild 4.33 zeigt die ermittelten Intensitäten auf dem Detektor in Abhängigkeit<br />
der zweidimensionalen Position des Partikels im Probenvolumen. Das Signal ist<br />
auf das theoretische Dunkelsignal im Detektorstreifen normiert. Eine Einschätzung<br />
der Kurven folgt in Kapitel 4.5.2.