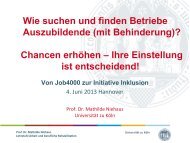[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
97<br />
In diesen Rahmen ordnet Volkert indirekte <strong>und</strong> direkte, relative <strong>und</strong> absolute sowie<br />
subjektive <strong>und</strong> objektive Ansätze der Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsmessung ein. Dabei<br />
vertritt er einen umfassenden methodischen Ansatz in dem Sinne, dass <strong>für</strong> unter-<br />
schiedliche Fragestellungen in unterschiedlichen Kontexten jeweils andere Methoden<br />
<strong>und</strong> Messindikatoren geeignet sein können: zur Frage der gesellschaftlichen Einkom-<br />
mensverteilung ein relatives Einkommensmaß, zur Frage des Mindestbedarfs ein<br />
direktes Armutsmaß, zur Frage der individuellen Ausstattung <strong>und</strong> der instrumentellen<br />
Freiheiten die ressourcen- <strong>und</strong> lebenslagenorientierten Ansätze.<br />
Wolfgang Voges thematisiert in seinem Vortrag „Perspektiven des Lebenslagen-<br />
konzeptes“ in gesellschaftstheoretischer Perspektive die Lebensbereiche, die im<br />
Hinblick auf Lebensqualität gr<strong>und</strong>legenden Stellenwert haben. In der Tradition von<br />
Neurath, Weisser <strong>und</strong> Nahnsen expliziert er zunächst das Lebenslagenkonzept als ein<br />
System von Handlungsspielräumen in Verbindung mit bereichsspezifischen Ressour-<br />
cen. Dabei legt Voges die Dimensionen zu Gr<strong>und</strong>e, über die seiner Ansicht nach in der<br />
Fachdiskussion Konsens besteht: Einkommen <strong>und</strong> Vermögen, Bildung, Erwerbstätig-<br />
keit, Wohnen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Eine theoretische oder empirische Ableitung dieser<br />
Dimensionen sieht er ebenso als noch zu leistende, zukünftige Forschungsaufgabe wie<br />
die Klärung der Gewichtung der einzelnen Dimensionen <strong>und</strong> ihrer wechselseitigen<br />
Beziehungen.<br />
Im Anschluss daran vertieft er zwei Aspekte des Lebenslagenansatzes. Zum einen<br />
weist er auf die Differenz zwischen objektiver Lebenslage <strong>und</strong> deren subjektiver Wahr-<br />
nehmung hin, die nicht immer kongruent sein muss, sondern auch besser („Zufrieden-<br />
heitsparadox“) oder schlechter („Unzufriedenheitsdilemma“) ausfallen kann. Zum<br />
andern geht er näher auf den „dualen Charakter“ von Lebenslagen ein, die sowohl eine<br />
„Ursache“ <strong>für</strong> Chancenungleichheit als auch deren „Folge“ sein könnten. Diese<br />
Spannung löst er anhand eines „dynamischen Modells der Wechselwirkungen<br />
zwischen strukturellen Bedingungen (Makroebene) <strong>und</strong> individuellem Handeln (Mikro-<br />
ebene)“ in ein zeitliches Nacheinander auf. Beide Aspekte, das Spannungsverhältnis<br />
zwischen objektiven Bedingungen <strong>und</strong> subjektiver Wahrnehmung sowie die Wechsel-<br />
wirkungen zwischen Makro- <strong>und</strong> Mikroebene, illustriert er anhand von Daten zur<br />
Wohnsituation in Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland.<br />
Zur praktischen Umsetzung des Lebenslagenansatzes in der Armuts- <strong>und</strong> Reichtums-<br />
berichterstattung empfiehlt er, pragmatisch bei leicht zu erhebenden Daten anzusetzen<br />
<strong>und</strong> von hier aus unter Berücksichtigung weiterer Dimensionen einen „Lebenslage-<br />
Index“ zu konstruieren.


![[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales](https://img.yumpu.com/6926455/101/500x640/begrussung-breuer-bundesministerium-fur-arbeit-und-soziales.jpg)

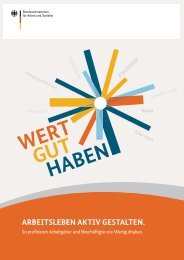
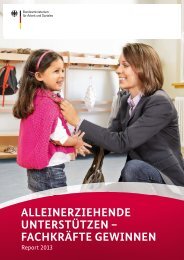



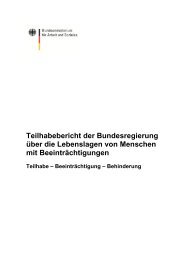
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)