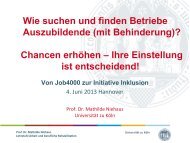[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diskussion der Impulsreferate<br />
Vom sozialphilosophischen Konzept der „Lebenslage“ zur empirischen Umsetzung<br />
98<br />
Bezüglich der Dimensionen der Lebenslage besteht weitgehender Konsens darüber,<br />
dass „Armut“ nicht nur als finanziell-ökonomische Deprivation zu sehen ist, sondern im<br />
Rahmen eines multidimensionalen Konzepts weitere Aspekte wie Ges<strong>und</strong>heit, Wohnen<br />
etc. zu berücksichtigen sind. In der empirischen Operationalisierung führt dieser ganz-<br />
heitliche Anspruch aber zu Problemen.<br />
In diesem Zusammenhang wird angeregt, bei der künftigen Armuts- <strong>und</strong> Reichtums-<br />
berichterstattung zunächst das Hauptaugenmerk auf einen Lebenslagenaspekt zu<br />
richten (z. B. auf Einkommen), diesen aber nicht isoliert zu betrachten, sondern als<br />
Ausgangspunkt zur Analyse von Wechselwirkungen mit anderen Aspekten zu nutzen.<br />
Da im Falle einer vollständigen Korrelation der einzelnen Dimensionen der Lebenslage<br />
die Hinzunahme weiterer Dimensionen keinen Informationsgewinn bringen würde, sind<br />
die Aspekte zu ermitteln, die mit anderen nur in geringerem Maße korrelieren, da sich<br />
darin ihre dimensionale Eigenständigkeit zeigt; so korrelieren z. B. „Bildung“ oder<br />
„Ges<strong>und</strong>heit“ weniger mit dem Einkommen als die „Wohnqualität“. Daher wird vorge-<br />
schlagen, ausgehend von der Dimension des Einkommens <strong>und</strong> Vermögens zu prüfen,<br />
welche anderen Dimensionen damit wenig korrelieren <strong>und</strong> dementsprechend eigen-<br />
ständig sind. Eine zweite Möglichkeit bestehe darin, ausgehend von einer relativen<br />
Einkommensgrenze zu versuchen, unterhalb dieser Abgrenzung Gruppen mit Mehr-<br />
fachdeprivation zu untersuchen, also mit niedrigem Einkommen <strong>und</strong> schlechter<br />
Wohnung, niedrigem Einkommen <strong>und</strong> defizitärer Bildung etc.<br />
Zu der von Volkert vorgenommenen Differenzierung in subjektive Ausstattung <strong>und</strong><br />
objektive Handlungsspielräume wird angemerkt, dass dem nicht die Unterscheidung<br />
von qualitativen <strong>und</strong> quantitativen Methoden entspricht, da auch subjektive Bewertun-<br />
gen quantifizierbar seien. Dies müsse in Form einer „Präferenzkontrolle“ Eingang in<br />
weitere Analysen finden, indem Deprivation nach subjektiver Präferenz gewichtet wird.<br />
Dieses Verfahren ist wichtig, um ein soziokulturelles Existenzminimum empirisch<br />
fassen zu können, bei dem zu unterscheiden ist zwischen jenen, die über die allgemein<br />
als notwendig angesehenen Güter nicht verfügen können <strong>und</strong> jenen, die an diesen<br />
Gütern nicht interessiert sind. Eine Grenze dieses Ansatzes besteht allerdings darin,<br />
dass individuelle Ansprüche auch über das allgemein als notwendig Erachtete hinaus-<br />
gehen können. Dies darf nicht dazu führen, dass der Armutsbegriff subjektiv beliebig<br />
wird.<br />
Im Hinblick auf die Bipolarität von „subjektiver Ausstattung“ <strong>und</strong> „objektiven Hand-<br />
lungsspielräumen“ werden Zweifel geäußert, ob sich diese Trennung konsequent<br />
durchführen lässt; so seien z. B. soziale Gr<strong>und</strong>rechte sowohl ein personenbezogenes<br />
Ausstattungsmerkmal als auch eine objektive, politisch gestaltbare Rahmenbedingung.


![[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales](https://img.yumpu.com/6926455/102/500x640/begrussung-breuer-bundesministerium-fur-arbeit-und-soziales.jpg)

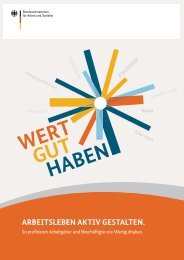
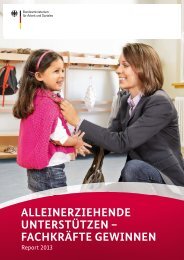



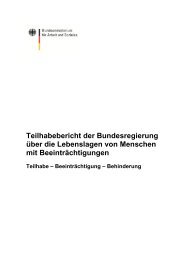
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)