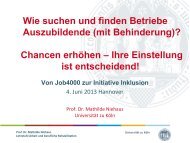[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
99<br />
Eine gr<strong>und</strong>sätzliche Anmerkung bezieht sich auf das Verhältnis der Konzepte<br />
„Ressource“ <strong>und</strong> „Lebenslage“. Bei der Analyse von Lebensqualität werden<br />
Ressourcen im Allgemeinen als „Input“ <strong>und</strong> Lebenslagen als „Output“ interpretiert. Aber<br />
wird nicht mit beiden Konzepten nur die potenzielle Güterverfügbarkeit auf der Input-<br />
seite gemessen <strong>und</strong> nicht das, was tatsächlich realisiert wird? Werden nicht erst im<br />
Transformationsprozess der Haushaltsproduktion die verfügbaren Ressourcen in eine<br />
konkrete Lebenslage umgewandelt? Diese Fragestellung spricht das von Voges<br />
erläuterte Spannungsverhältnis von Lebenslage einerseits als Einflussfaktor <strong>und</strong><br />
andererseits als Resultat an. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass<br />
die Trennung von Input- <strong>und</strong> Output-Faktoren nicht statisch sei: So fungiert etwa ein<br />
bestimmtes Qualifikationsniveau, das am Ende eines Bildungsprozesses als Output<br />
erscheint, in Bezug auf das Beschäftigungssystem wiederum als Input-Faktor.<br />
Der theoretische Ansatz von Volkert erhebt auch den Anspruch, den Prozess zu analy-<br />
sieren, wie mit Ressourcen umgegangen wird. Die individuelle Ausstattung mit verfüg-<br />
baren Ressourcen muss mit dem Ergebnis, d. h. dem Grad der Zielverwirklichung<br />
verglichen <strong>und</strong> darauf hin geprüft werden, inwieweit instrumentelle Freiheiten vorhan-<br />
den waren <strong>und</strong> wie effektiv sie genutzt wurden.<br />
Ein weiterer Diskussionsbeitrag spricht an, dass der erste Armuts- <strong>und</strong> Reichtums-<br />
bericht die personelle Verteilung in den Vordergr<strong>und</strong> stelle, nicht aber die „funktionale“<br />
Verteilung von Ressourcen analysiert, d.h. wie sich die Einkommenslagen einzelner<br />
gesellschaftlicher Gruppen entwickelt haben. Die Besteuerung von Lohneinkommen<br />
sei gestiegen, die Belastung von Gewinn- <strong>und</strong> Kapitaleinkommen gleichzeitig aber<br />
gesunken. Diese „Scherenentwicklung“ sei eine unmittelbare Ursache <strong>für</strong> Finan-<br />
zierungsprobleme der öffentlichen Hand, die die Möglichkeiten beeinträchtigen, Armut<br />
effektiv zu bekämpfen. Gegen diesen Einwand wird allerdings geltend gemacht, dass<br />
die funktionale Verteilung nicht mehr so eindeutig erkennbar sei wie in früheren Zeiten,<br />
da die Trennungslinie zwischen „ärmeren“ Lohn- <strong>und</strong> Gehaltsbeziehern einerseits <strong>und</strong><br />
„reicheren“ Selbstständigen andererseits durch neue <strong>Arbeit</strong>s- <strong>und</strong> Beschäftigungs-<br />
formen teilweise verwischt werde.<br />
Spektrum relevanter Dimensionen der Lebenslage<br />
Breiten Raum nimmt die Diskussion ein, welche weiteren Aspekte in der zukünftigen<br />
Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsberichterstattung einen höheren Stellenwert erhalten sollen.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird in Frage gestellt, ob es sich bei den von Voges als „klassisch“<br />
bezeichneten fünf Dimensionen tatsächlich um einen theoretisch <strong>und</strong> empirisch<br />
begründeten „Kanon“ handelt, oder ob diese Auswahl eher vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
verfügbarer Daten pragmatisch getroffen worden sei (was auch Voges selbst ange-<br />
sprochen hatte).


![[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales](https://img.yumpu.com/6926455/103/500x640/begrussung-breuer-bundesministerium-fur-arbeit-und-soziales.jpg)

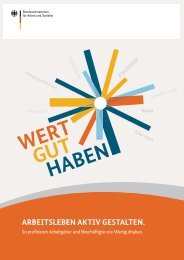
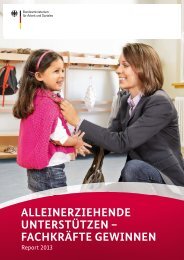



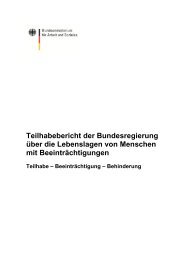
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)