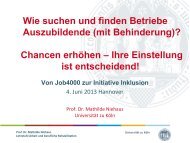[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
23<br />
Subjektive Armutsmaße (Annahme: Verschiedenartige individuelle Anspruchsniveaus)<br />
Kann kein Konsens über die Armutsgrenze (<strong>und</strong> deren Bestimmungsgrößen) voraus-<br />
gesetzt werden, sind subjektive Ansätze erforderlich. Sie ermöglichen z. B. durch<br />
Befragungen eine Annäherung an jene – von den vielfältigen Werturteilen abhängigen<br />
– Größen, die als unabdingbar <strong>für</strong> das Erreichen der Armutsschwelle angesehen<br />
werden. Zu denken ist beispielsweise an die Bestimmung der soziokulturellen Aspekte<br />
eines Existenzminimums, die sehr stark von den Werturteilen in der Bevölkerung<br />
abhängen.<br />
Subjektive Ansätze ermitteln ferner, ob das Unterschreiten objektiver Armutsgrenzen<br />
kein Armutssymptom, sondern Konsequenz eines freiwilligen (nicht finanziell oder<br />
gesellschaftlich bedingten) Verzichts ist.<br />
Beispielsweise haben nach eigenen Angaben 4 % der Westdeutschen <strong>und</strong> 5 % der<br />
Ostdeutschen nicht täglich eine warme Mahlzeit. Doch nur jeweils 1 % der Personen in<br />
West <strong>und</strong> Ost verzichtet aus finanziellen Gründen auf die tägliche warme Mahlzeit. Die<br />
übrigen 3 % bzw. 4 % verzichten „aus anderen Gründen“ (z. B. aus Zeitmangel, wegen<br />
Diät u. Ä.) auf eine tägliche warme Mahlzeit. 9 Anders als in einem Land der „vierten<br />
Welt“ kann man sich in einem im Durchschnitt wohlhabenden Land aus freien Stücken<br />
zum Verzicht auf ansonsten sehr weit verbreitete Dinge entscheiden, ohne hierdurch<br />
existenziell gefährdet zu sein. Eine Beurteilung der Situation nach objektiven Kriterien<br />
wäre hier nicht angemessen, da sie den Zielen der Betreffenden widerspräche.<br />
Grenzen subjektiver Ansätze liegen dort, wo die erfragten Einschätzungen auf Unwis-<br />
senheit beruhen oder Zufriedenheit Ausdruck von Resignation <strong>und</strong> Gewöhnung ist. In<br />
diesen Fällen bietet sich eine Korrektur subjektiver Maße durch Expertenwissen an.<br />
Nicht nur die Eignung der Messkonzepte, auch der Anwendungsbereich der einzelnen<br />
Armutsindikatoren lässt sich mit Hilfe des hier skizzierten methodischen Ansatzes ab-<br />
grenzen. Schließlich ist jeder einzelne Indikator entweder subjektiv oder objektiv, direkt<br />
oder indirekt <strong>und</strong> absolut oder relativ. An einem Beispiel soll dies verdeutlicht werden.<br />
Der Ansatz der Verwirklichungschancen als Analyserahmen <strong>für</strong> Möglichkeiten <strong>und</strong><br />
Grenzen von Armutsindikatoren – Beispiel: die „50 %-Einkommensarmut“<br />
Ein Indikator, der Armut als Unterschreiten einer Einkommensgrenze von 50 % eines<br />
Einkommensmittelwertes der Gesamtbevölkerung beschreibt, ist ein relativer, objek-<br />
tiver, indirekter <strong>und</strong> monetärer Armutsindikator. Er trifft also implizit folgende Annah-<br />
men über die Bestimmungsgrößen der Zielverwirklichung:<br />
• Abhängigkeit der Armutsgrenzen von gesellschaftlichen Verwirklichungschancen<br />
9<br />
Datenreport (1999)


![[Begrüßung Breuer] - Bundesministerium für Arbeit und Soziales](https://img.yumpu.com/6926455/27/500x640/begrussung-breuer-bundesministerium-fur-arbeit-und-soziales.jpg)

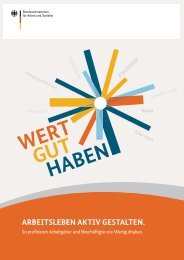
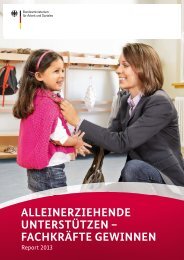



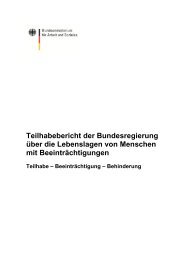
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)