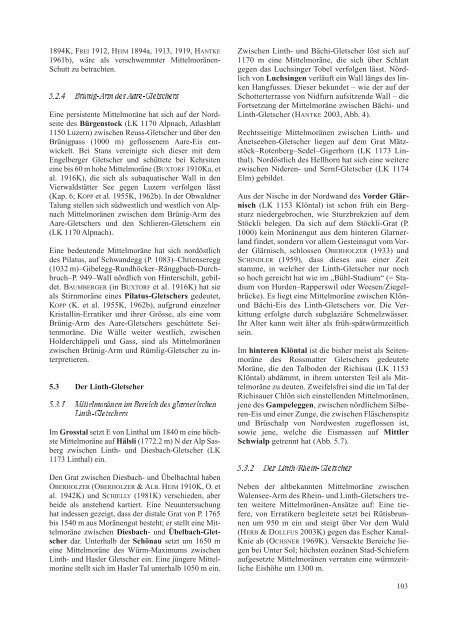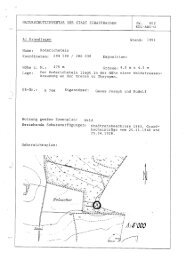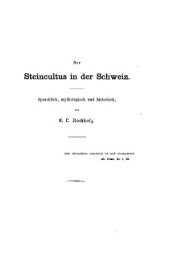Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1894K, FREI 1912, HEIM 1894a, 1913, 1919, HANTKE<br />
1961b), wäre als verschwemmter Mittelmoränen-<br />
Schutt zu betrachten.<br />
Eine persistente Mittelmoräne hat sich auf der Nordseite<br />
des Bürgenstock (LK 1170 Alpnach, Atlasblatt<br />
1150 Luzern) zwischen Reuss-Gletscher <strong>und</strong> über den<br />
Brünigpass (1000 m) geflossenem Aare-Eis entwickelt.<br />
Bei Stans vereinigte sich dieser mit dem<br />
Engelberger Gletscher <strong>und</strong> schüttete bei Kehrsiten<br />
eine bis 60 m hohe Mittelmoräne (BUXTORF 1910Ka, et<br />
al. 1916K), die sich als subaquatischer Wall in den<br />
Vierwaldstätter See gegen Luzern verfolgen lässt<br />
(Kap. 6; KOPP et al. 1955K, 1962b). In der Obwaldner<br />
Talung stellen sich südwestlich <strong>und</strong> westlich von Alpnach<br />
Mittelmoränen zwischen dem Brünig-Arm des<br />
Aare-Gletschers <strong>und</strong> den Schlieren-Gletschern ein<br />
(LK 1170 Alpnach).<br />
Eine bedeutende Mittelmoräne hat sich nordöstlich<br />
des Pilatus, auf Schwandegg (P. 1083)–Chrienseregg<br />
(1032 m)–Gibelegg-R<strong>und</strong>höcker–Ränggbach-Durchbruch–P.<br />
949–Wall nördlich von Hinterschilt, gebildet.<br />
BAUMBERGER (in BUXTORF et al. 1916K) hat sie<br />
als Stirnmoräne eines Pilatus-Gletschers gedeutet,<br />
KOPP (K. et al. 1955K, 1962b), aufgr<strong>und</strong> einzelner<br />
Kristallin-Erratiker <strong>und</strong> ihrer Grösse, als eine vom<br />
Brünig-Arm des Aare-Gletschers geschüttete Seitenmoräne.<br />
Die Wälle weiter westlich, zwischen<br />
Holderchäppeli <strong>und</strong> Gass, sind als Mittelmoränen<br />
zwischen Brünig-Arm <strong>und</strong> Rümlig-Gletscher zu interpretieren.<br />
5.3 Der Linth-Gletscher<br />
Im Grosstal setzt E von Linthal um 1840 m eine höchste<br />
Mittelmoräne auf Hälsli (1772.2 m) N der Alp Sasberg<br />
zwischen Linth- <strong>und</strong> Diesbach-Gletscher (LK<br />
1173 Linthal) ein.<br />
Den Grat zwischen Diesbach- <strong>und</strong> Übelbachtal haben<br />
OBERHOLZER (OBERHOLZER & ALB. HEIM 1910K, O. et<br />
al. 1942K) <strong>und</strong> SCHIELLY (1981K) verschieden, aber<br />
beide als anstehend kartiert. Eine Neuuntersuchung<br />
hat indessen gezeigt, dass der distale Grat von P. 1765<br />
bis 1540 m aus Moränengut besteht; er stellt eine Mittelmoräne<br />
zwischen Diesbach- <strong>und</strong> Übelbach-Gletscher<br />
dar. Unterhalb der Schönau setzt um 1650 m<br />
eine Mittelmoräne des Würm-Maximums zwischen<br />
Linth- <strong>und</strong> Hasler Gletscher ein. Eine jüngere Mittelmoräne<br />
stellt sich im Hasler Tal unterhalb 1050 m ein.<br />
Zwischen Linth- <strong>und</strong> Bächi-Gletscher löst sich auf<br />
1170 m eine Mittelmoräne, die sich über Schlatt<br />
gegen das Luchsinger Tobel verfolgen lässt. Nördlich<br />
von Luchsingen verläuft ein Wall längs des linken<br />
Hangfusses. Dieser bek<strong>und</strong>et – wie der auf der<br />
Schotterterrasse von Nidfurn aufsitzende Wall – die<br />
Fortsetzung der Mittelmoräne zwischen Bächi- <strong>und</strong><br />
Linth-Gletscher (HANTKE 2003, Abb. 4).<br />
Rechtsseitige Mittelmoränen zwischen Linth- <strong>und</strong><br />
Änetseeben-Gletscher liegen auf dem Grat Mätzstöck–Rotenberg–Sedel–Gigerhorn<br />
(LK 1173 Linthal).<br />
Nordöstlich des Hellhorn hat sich eine weitere<br />
zwischen Nideren- <strong>und</strong> Sernf-Gletscher (LK 1174<br />
Elm) gebildet.<br />
Aus der Nische in der Nordwand des Vorder Glärnisch<br />
(LK 1153 Klöntal) ist schon früh ein Bergsturz<br />
niedergebrochen, wie Sturzbrekzien auf dem<br />
Stöckli belegen. Da sich auf dem Stöckli-Grat (P.<br />
1000) kein Moränengut aus dem hinteren Glarnerland<br />
findet, sondern vor allem Gesteinsgut vom Vorder<br />
Glärnisch, schlossen OBERHOLZER (1933) <strong>und</strong><br />
SCHINDLER (1959), dass dieses aus einer Zeit<br />
stamme, in welcher der Linth-Gletscher nur noch<br />
so hoch gereicht hat wie im „Bühl-Stadium“ (= Stadium<br />
von Hurden–Rapperswil oder Weesen/Ziegelbrücke).<br />
Es liegt eine Mittelmoräne zwischen Klön<strong>und</strong><br />
Bächi-Eis des Linth-Gletschers vor. Die Verkittung<br />
erfolgte durch subglaziäre Schmelzwässer.<br />
Ihr Alter kann weit älter als früh-spätwürmzeitlich<br />
sein.<br />
Im hinteren Klöntal ist die bisher meist als Seitenmoräne<br />
des Rossmatter Gletschers gedeutete<br />
Moräne, die den Talboden der Richisau (LK 1153<br />
Klöntal) abdämmt, in ihrem untersten Teil als Mittelmoräne<br />
zu deuten. Zweifelsfrei sind die im Tal der<br />
Richisauer Chlön sich einstellenden Mittelmoränen,<br />
jene des Gampeleggen, zwischen nördlichem Silberen-Eis<br />
<strong>und</strong> einer Zunge, die zwischen Fläschenspitz<br />
<strong>und</strong> Brüschalp von Nordwesten zugeflossen ist,<br />
sowie jene, welche die Eismassen auf Mittler<br />
Schwialp getrennt hat (Abb. 5.7).<br />
Neben der altbekannten Mittelmoräne zwischen<br />
Walensee-Arm des Rhein- <strong>und</strong> Linth-Gletschers treten<br />
weitere Mittelmoränen-Ansätze auf: Eine tiefere,<br />
von Erratikern begleitete setzt bei Rütisbrunnen<br />
um 950 m ein <strong>und</strong> steigt über Vor dem Wald<br />
(HERB & DOLLFUS 2003K) gegen das Escher Kanal-<br />
Knie ab (OCHSNER 1969K). Versackte Bereiche liegen<br />
bei Unter Sol; höchsten eozänen Stad-Schiefern<br />
aufgesetzte Mittelmoränen verraten eine würmzeitliche<br />
Eishöhe um 1300 m.<br />
103