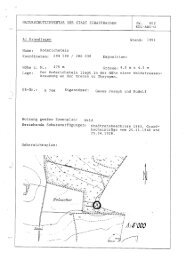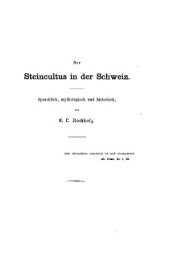Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Von den zu Kluftmessungen besuchten Aufschlüssen<br />
(Abb. 4.3) liegen acht auf dem E-Ufer zwischen Küssnacht<br />
<strong>und</strong> Hertenstein, bei Küssnacht noch eine in verkitteten<br />
eiszeitlichen Schottern <strong>und</strong> im aquitanen<br />
Sandstein, zwischen Greppen <strong>und</strong> Eggisbüel in den<br />
Grisiger Mergeln, rezentem Quelltuff auf einer Unterlage<br />
von USM-Nagelfluh <strong>und</strong> Weggiser Kalksandstein;<br />
am W-Ufer wurde an einer Stelle in der USM bei<br />
Meggen gemessen.<br />
Der Luzerner See verdankt seine Anlage + senkrecht<br />
zur Streichrichtung laufenden Querstörungen.<br />
Kluftmessungen wurden an acht Stellen (Abb. 4.3)<br />
vorgenommen, vier am NE-Ufer zwischen Luzern <strong>und</strong><br />
Meggenhorn in Sandsteinen <strong>und</strong> Nagelfluh der aquitanen<br />
USM, in Luzern in der OMM beim Löwendenkmal,<br />
drei lagen zwischen Luzern <strong>und</strong> St. Niklausen, in Bunter<br />
Nagelfluh <strong>und</strong> Sandsteinen der aquitanen USM.<br />
Die Horwer Bucht verdankt ihre Entstehung Querstörungen.<br />
Das Seewligrat-Gewölbe entspricht jenem<br />
des Mueterschwanderberg. Das verlandete Seestück<br />
von Buochs nach Stans <strong>und</strong> seine Fortsetzung ins Drachenried<br />
entsprechen der Trennung zwischen Silberen-<br />
<strong>und</strong> Drusberg-Decke (HANTKE 1961a).<br />
Kluftstellungen wurden an 19 Aufschlüssen gemessen<br />
(Abb. 4.3). Die ersten fünf Messungen wurden im<br />
Kieselkalk von Kehrsiten-Dorf nach Stansstad vorgenommen,<br />
die nächsten drei zwischen dem Ausfluss des<br />
Alpnacher Sees <strong>und</strong> Hergiswil, weitere an der Horwer<br />
Bucht, ihrer drei zwischen Utohorn <strong>und</strong> dem Winkel in<br />
Horw in aquitaner Bunter Nagelfluh <strong>und</strong> Kalksandstein<br />
der USM <strong>und</strong> vier über dem W-Ufer der Horwer<br />
Bucht in Mergeln, Kalksandstein, Molasse Rouge <strong>und</strong><br />
Grisiger Mergeln.<br />
Die Richtungen der Zuflüsse konnten nur für den<br />
ganzen Chrüztrichter, nicht aber für einzelne Teile<br />
berechnet werden, da sich nur wenige Richtungsdaten<br />
ergaben.<br />
Das Vitznauer Becken liegt zwischen der helvetischen<br />
Bürgenstock-Kette <strong>und</strong> der gegen S knickartig steiler<br />
einfallenden Rigi-Molasse-Schuppe. Die Halbinsel<br />
Hertenstein ist an einer Blattverschiebung weiter nach<br />
NW <strong>und</strong> zugleich tiefer gesetzt worden. Analoge Verschiebungen<br />
sind von der NW-Seite des Küssnachter<br />
Sees bekannt (BUXTORF & KOPP 1944). Sie zeigen,<br />
dass auch die steilstehende <strong>und</strong> aufgerichtete Molasse<br />
zwischen der Luzerner Bucht <strong>und</strong> dem Zuger See ana-<br />
Abb. 4.7 Messstelle Seewligrat<br />
logen Verscherungen unterworfen waren. Im See-<br />
Durchbruch zwischen den Nasen zeichnet sich ein<br />
komplementär wirkendes Grenzblatt ab. Dabei blieb<br />
die Bürgenstock-Kette im SW zurück. Zwischen Stans<br />
<strong>und</strong> Stansstad verlaufen erneut Grenzblätter. Der Mueterschwanderberg<br />
blieb gegenüber dem Bürgenstock<br />
im S in tieferer Position zurück. Im Rotzloch-Durchbruch<br />
liegt erneut eine komplementäre Störung vor.<br />
Da sich durch solche Grenzblätter, Blattverschiebungen<br />
in den Decken, am Alpenrand ein Streckungseffekt<br />
ergibt, hat sie BUXTORF (1913K, et al. 1916K)<br />
„Streckungsbrüche“ genannt. Der Richtungstrend<br />
des Sees ist E–W.<br />
Für Kluftmessungen am Vitznauer Becken ist die N-<br />
Seite zwischen Hertenstein <strong>und</strong> Ober Nas gut zugänglich;<br />
an ihr wurden 13 Stellen eingemessen (Abb. 4.3);<br />
sieben zwischen Hertenstein <strong>und</strong> Hinter Lützelau in<br />
Sandstein, Kalk-Sandstein <strong>und</strong> Nagelfluh der USM,<br />
drei am Abhang der Rigi ob Vitznau in der Rigi-Nagelfluh<br />
<strong>und</strong> drei zwischen Vitznau <strong>und</strong> Ober Nas im Helvetischen<br />
Kieselkalk <strong>und</strong> im Schrattenkalk.<br />
Auf der S-Seite ist das Ufer nur teilweise zugänglich<br />
oder besteht aus Hangschutt. Die dem See am nächsten<br />
gelegenen Aufschlüsse finden sich am Bürgenstock<br />
(Abb. 4.3). Die zehn Messstellen lagen im alttertiären<br />
Assilinen-Grünsandstein, im Seewer Kalk, im Schrattenkalk,<br />
in der Garschella-Formation <strong>und</strong> im Nummulitenkalk.<br />
Bachrichtungen wurden wieder nur für das gesamte<br />
Becken berechnet: Im S ergaben sich am Bürgenstock<br />
keine Richtungstrends; messbare Bäche entwässern<br />
zum N-Ufer (Abb. 4.3).<br />
Das Gersauer Becken bildete sich zwischen dem Seelisberg-Stirngewölbe<br />
der Drusberg-Decke <strong>und</strong> den<br />
von ihr an den Alpenrand geschleppten Schuppen der<br />
Axen-Decke. Dabei entspricht die tiefere, die Hoch-<br />
89