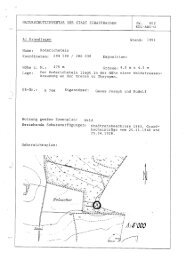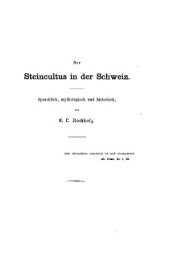Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zusammenfassung<br />
Nachdem versucht worden ist, das Überdauern von<br />
Kaltzeiten durch Alpenpflanzen im Rigi- <strong>und</strong> Brienzer<br />
Rothorn-Gebiet oberhalb der Vereisungsgrenze wahrscheinlich<br />
darzulegen, erhebt sich die Frage nach<br />
einem weiteren Zurückverfolgen von Landschafts<strong>und</strong><br />
Vegetationsgeschichte, insbesondere der Herkunft<br />
<strong>und</strong> Einwanderungsgeschichte von Alpenpflanzen<br />
nachzugehen. Nach einer Diskussion einiger neu zu<br />
überdenkender geologischer Probleme – Molasse-<br />
Schuttfächerbildung, glaziale Übertiefung von Alpentälern,<br />
Gr<strong>und</strong>moränenbildung, fluviales Eintiefen von<br />
Tälern, Abtrag ganzer Deckenteile – wird versucht,<br />
eine Landschaftsgeschichte der Zentralschweiz <strong>und</strong><br />
des östlichen Berner Oberlandes zwischen dem jüngeren<br />
Oligozän <strong>und</strong> dem Pliozän zu entwerfen.<br />
Während die <strong>Schwyz</strong>er Klippen durch eine Ur-Panixerpass-<br />
<strong>und</strong> eine Ur-Bisistal-Quersenke aus dem<br />
Grenzbereich von penninischem <strong>und</strong> ostalpinem Ablagerungsraum<br />
an den Alpenrand vorgeglitten sind, bietet<br />
sich für die Obwaldner Klippen ein Vorgleiten<br />
durch eine Ur-Hasli-Depression an.<br />
Die Anlage der Becken des Vierwaldstätter <strong>und</strong> des<br />
Zuger Sees sind durch Grenzblätter, Deckengrenzen<br />
<strong>und</strong> aufgebrochene Gewölbe tektonisch bedingt. Die<br />
Schüttung des Rigi-Schuttfächers erfolgte im Wechsel<br />
von kühlzeitlichen Geröllschüben mit warmzeitlichen,<br />
fossilführenden Feinsedimenten.<br />
Die Quersenken Ur-Panixerpass–Ur-Bisistal im Osten<br />
<strong>und</strong> Ossola-Tal–Gries–Grimsel–Hasli im Westen bek<strong>und</strong>en<br />
– neben der Bewegungsbahn von Deckenteilen,<br />
eine noch ältere Talung für die Molasseschüttungen<br />
– die Möglichkeit für einen jungoligozänen <strong>und</strong><br />
miozänen Floren-Austausch. Auf unterschiedlichem<br />
Substrat <strong>und</strong> Höhenlage boten sie bei wiederholtem<br />
Klimawechsel noch im jüngeren Tertiär <strong>und</strong> im Eiszeitalter<br />
Wanderrouten für Floren <strong>und</strong> Faunen zwischen<br />
Alpen-Süd- <strong>und</strong> -Nord-Seite.<br />
7.1 Einleitung<br />
Bei Kartierungen in der Zentralschweiz <strong>und</strong> den Glarner<br />
Alpen für den Geologischen Atlas der Schweiz <strong>und</strong><br />
beim Fahnden nach möglichen präglazialen Florenrelikten<br />
(HANTKE et al. 2001) wurde versucht, für Rigi<br />
<strong>und</strong> Brienzer Rothorn eine Landschaftgeschichte zu<br />
entwerfen. Mit dem zeitlichen Ablauf des geologi-<br />
110<br />
7 Zur Landschaftsgeschichte der Zentralschweiz<br />
<strong>und</strong> des östlichen Berner Oberlandes<br />
René Hantke<br />
schen Geschehens, einer Geschichte des Reliefs, kann<br />
es – zusammen mit der geschichtlichen Entwicklung<br />
des floristischen Inhaltes der Vegetationsdecke – gelingen,<br />
möglichen Einwanderungswegen kühl- <strong>und</strong> kaltzeitlicher<br />
Floren nachzuspüren.<br />
7.2 Neu zu überdenkende erdgeschichtliche<br />
Lehrmeinungen<br />
Die Molasse-Schuttfächer werden – aufgr<strong>und</strong> ihres<br />
Fossilinhaltes, vor allem ihrer warm-gemässigten–<br />
subtropischen Florenelemente – meist als warmzeitliche<br />
Ablagerungen alpiner Flüsse in ein flaches Vorland,<br />
zeitweise in ein seichtes Randmeer, betrachtet.<br />
Über Jahrzehnte sich erstreckende Arbeiten in<br />
Molasse-Schuttfächern haben gezeigt, dass die Schüttungen<br />
mit ihrem Geröllinhalt (Gesteinsnatur, Geröllgrösse,<br />
Einregelung) <strong>und</strong> der Ausdehnung der Nagelfluhbänke<br />
längs <strong>und</strong> quer zur Strömungsrichtung<br />
kaum nur durch alpine Flüsse mit Hochwasserspitzen<br />
geschüttet worden sein können; dies schon gar nicht<br />
unter warm-gemässigtem–subtropischem Klima mit<br />
hoher Waldgrenze, bei dem ein Teil des Niederschlags<br />
vom Wald an die Atmosphäre zurückgegeben <strong>und</strong> ein<br />
weiterer vom Wurzelwerk zurückgehalten wird.<br />
In Warmzeiten wurden vor allem feinkörnige Sedimente<br />
abgelagert, <strong>und</strong> warmzeitliche Pflanzengesellschaften<br />
besiedelten das Alpenvorland. Aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
Polleninhalte (HOCHULI 1978, EBERHARD 1986, 1989)<br />
waren weite Gebiete der Alpen-N-Seite von Laubmischwäldern,<br />
höhere Lagen von Nadelwäldern bestockt.<br />
Oft über Kilometer verfolgbare grobgeröllige<br />
Nagelfluhbänke bek<strong>und</strong>en aber nicht gleichzeitig<br />
erfolgte Ablagerungen in Flussbetten. Zudem waren<br />
die jungoligozänen <strong>und</strong> miozänen Alpen kaum viel<br />
breiter <strong>und</strong> die Wasserscheide bald einmal erreicht.<br />
Selbst sintflutartige Starkniederschläge <strong>und</strong> ein bedeutendes<br />
Relief konnten nicht genügen, um N-alpine<br />
Flüsse mit ihrer Schuttfracht so weit ins Vorland vordringen<br />
<strong>und</strong> diese in km-breiten Strängen ablagern zu<br />
lassen.<br />
Die beobachtbaren Fakten sprechen für plötzliche<br />
Ausbrüche alpiner, durch Rüfen <strong>und</strong> Bergstürze