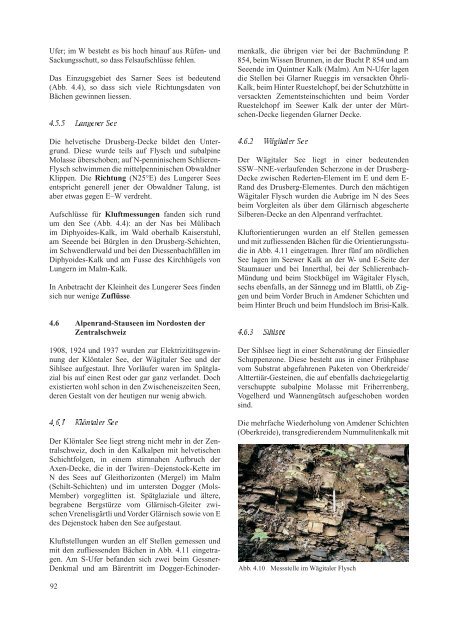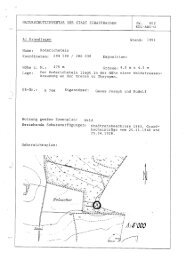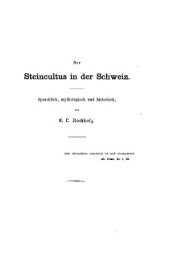Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ufer; im W besteht es bis hoch hinauf aus Rüfen- <strong>und</strong><br />
Sackungsschutt, so dass Felsaufschlüsse fehlen.<br />
Das Einzugsgebiet des Sarner Sees ist bedeutend<br />
(Abb. 4.4), so dass sich viele Richtungsdaten von<br />
Bächen gewinnen liessen.<br />
Die helvetische Drusberg-Decke bildet den Untergr<strong>und</strong>.<br />
Diese wurde teils auf Flysch <strong>und</strong> subalpine<br />
Molasse überschoben; auf N-penninischem Schlieren-<br />
Flysch schwimmen die mittelpenninischen Obwaldner<br />
Klippen. Die Richtung (N25°E) des Lungerer Sees<br />
entspricht generell jener der Obwaldner Talung, ist<br />
aber etwas gegen E–W verdreht.<br />
Aufschlüsse für Kluftmessungen fanden sich r<strong>und</strong><br />
um den See (Abb. 4.4): an der Nas bei Mülibach<br />
im Diphyoides-Kalk, im Wald oberhalb Kaiserstuhl,<br />
am Seeende bei Bürglen in den Drusberg-Schichten,<br />
im Schwendlerwald <strong>und</strong> bei den Diessenbachfällen im<br />
Diphyoides-Kalk <strong>und</strong> am Fusse des Kirchhügels von<br />
Lungern im Malm-Kalk.<br />
In Anbetracht der Kleinheit des Lungerer Sees finden<br />
sich nur wenige Zuflüsse<br />
4.6 Alpenrand-Stauseen im Nordosten der<br />
Zentralschweiz<br />
1908, 1924 <strong>und</strong> 1937 wurden zur Elektrizitätsgewinnung<br />
der Klöntaler See, der Wägitaler See <strong>und</strong> der<br />
Sihlsee aufgestaut. Ihre Vorläufer waren im Spätglazial<br />
bis auf einen Rest oder gar ganz verlandet. Doch<br />
existierten wohl schon in den Zwischeneiszeiten Seen,<br />
deren Gestalt von der heutigen nur wenig abwich.<br />
Der Klöntaler See liegt streng nicht mehr in der Zentralschweiz,<br />
doch in den Kalkalpen mit helvetischen<br />
Schichtfolgen, in einem stirnnahen Aufbruch der<br />
Axen-Decke, die in der Twiren–Dejenstock-Kette im<br />
N des Sees auf Gleithorizonten (Mergel) im Malm<br />
(Schilt-Schichten) <strong>und</strong> im untersten Dogger (Mols-<br />
Member) vorgeglitten ist. Spätglaziale <strong>und</strong> ältere,<br />
begrabene Bergstürze vom Glärnisch-Gleiter zwischen<br />
Vrenelisgärtli <strong>und</strong> Vorder Glärnisch sowie von E<br />
des Dejenstock haben den See aufgestaut.<br />
Kluftstellungen wurden an elf Stellen gemessen <strong>und</strong><br />
mit den zufliessenden Bächen in Abb. 4.11 eingetragen.<br />
Am S-Ufer befanden sich zwei beim Gessner-<br />
Denkmal <strong>und</strong> am Bärentritt im Dogger-Echinoder-<br />
92<br />
menkalk, die übrigen vier bei der Bachmündung P.<br />
854, beim Wissen Brunnen, in der Bucht P. 854 <strong>und</strong> am<br />
Seeende im Quintner Kalk (Malm). Am N-Ufer lagen<br />
die Stellen bei Glarner Rueggis im versackten Öhrli-<br />
Kalk, beim Hinter Ruestelchopf, bei der Schutzhütte in<br />
versackten Zementsteinschichten <strong>und</strong> beim Vorder<br />
Ruestelchopf im Seewer Kalk der unter der Mürtschen-Decke<br />
liegenden Glarner Decke.<br />
Der Wägitaler See liegt in einer bedeutenden<br />
SSW–NNE-verlaufenden Scherzone in der Drusberg-<br />
Decke zwischen Rederten-Element im E <strong>und</strong> dem E-<br />
Rand des Drusberg-Elementes. Durch den mächtigen<br />
Wägitaler Flysch wurden die Aubrige im N des Sees<br />
beim Vorgleiten als über dem Glärnisch abgescherte<br />
Silberen-Decke an den Alpenrand verfrachtet.<br />
Kluftorientierungen wurden an elf Stellen gemessen<br />
<strong>und</strong> mit zufliessenden Bächen für die Orientierungsstudie<br />
in Abb. 4.11 eingetragen. Ihrer fünf am nördlichen<br />
See lagen im Seewer Kalk an der W- <strong>und</strong> E-Seite der<br />
Staumauer <strong>und</strong> bei Innerthal, bei der Schlierenbach-<br />
Mündung <strong>und</strong> beim Stockbügel im Wägitaler Flysch,<br />
sechs ebenfalls, an der Sännegg <strong>und</strong> im Blattli, ob Ziggen<br />
<strong>und</strong> beim Vorder Bruch in Amdener Schichten <strong>und</strong><br />
beim Hinter Bruch <strong>und</strong> beim H<strong>und</strong>sloch im Brisi-Kalk.<br />
Der Sihlsee liegt in einer Scherstörung der Einsiedler<br />
Schuppenzone. Diese besteht aus in einer Frühphase<br />
vom Substrat abgefahrenen Paketen von Oberkreide/<br />
Alttertiär-Gesteinen, die auf ebenfalls dachziegelartig<br />
verschuppte subalpine Molasse mit Friherrenberg,<br />
Vogelherd <strong>und</strong> Wannengütsch aufgeschoben worden<br />
sind.<br />
Die mehrfache Wiederholung von Amdener Schichten<br />
(Oberkreide), transgredierendem Nummulitenkalk mit<br />
Abb. 4.10 Messstelle im Wägitaler Flysch