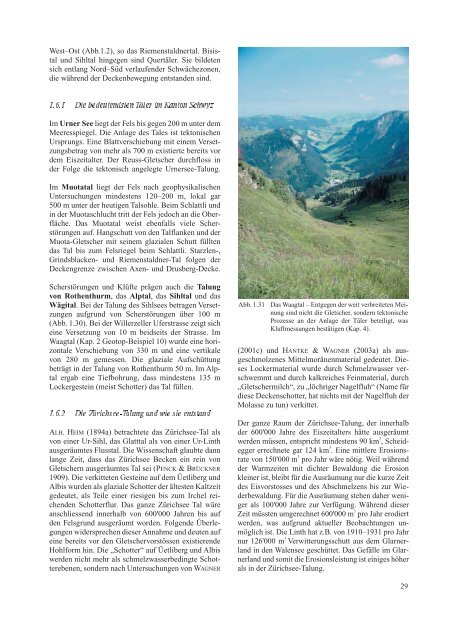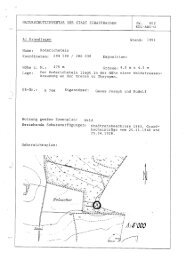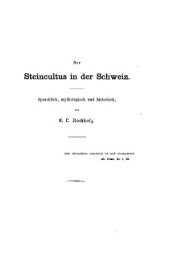Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
West–Ost (Abb.1.2), so das Riemenstaldnertal. Bisistal<br />
<strong>und</strong> Sihltal hingegen sind Quertäler. Sie bildeten<br />
sich entlang Nord–Süd verlaufender Schwächezonen,<br />
die während der Deckenbewegung entstanden sind.<br />
Im Urner See liegt der Fels bis gegen 200 m unter dem<br />
Meeresspiegel. Die Anlage des Tales ist tektonischen<br />
Ursprungs. Eine Blattverschiebung mit einem Versetzungsbetrag<br />
von mehr als 700 m existierte bereits vor<br />
dem Eiszeitalter. Der Reuss-Gletscher durchfloss in<br />
der Folge die tektonisch angelegte Urnersee-Talung.<br />
Im Muotatal liegt der Fels nach geophysikalischen<br />
Untersuchungen mindestens 120–200 m, lokal gar<br />
500 m unter der heutigen Talsohle. Beim Schlattli <strong>und</strong><br />
in der Muotaschlucht tritt der Fels jedoch an die Oberfläche.<br />
Das Muotatal weist ebenfalls viele Scherstörungen<br />
auf. Hangschutt von den Talflanken <strong>und</strong> der<br />
Muota-Gletscher mit seinem glazialen Schutt füllten<br />
das Tal bis zum Felsriegel beim Schlattli. Starzlen-,<br />
Grindsblacken- <strong>und</strong> Riemenstaldner-Tal folgen der<br />
Deckengrenze zwischen Axen- <strong>und</strong> Drusberg-Decke.<br />
Scherstörungen <strong>und</strong> Klüfte prägen auch die Talung<br />
von Rothenthurm, das Alptal, das Sihltal <strong>und</strong> das<br />
Wägital. Bei der Talung des Sihlsees betragen Versetzungen<br />
aufgr<strong>und</strong> von Scherstörungen über 100 m<br />
(Abb. 1.30). Bei der Willerzeller Uferstrasse zeigt sich<br />
eine Versetzung von 10 m beidseits der Strasse. Im<br />
Waagtal (Kap. 2 Geotop-Beispiel 10) wurde eine horizontale<br />
Verschiebung von 330 m <strong>und</strong> eine vertikale<br />
von 280 m gemessen. Die glaziale Aufschüttung<br />
beträgt in der Talung von Rothenthurm 50 m. Im Alptal<br />
ergab eine Tiefbohrung, dass mindestens 135 m<br />
Lockergestein (meist Schotter) das Tal füllen.<br />
ALB. HEIM (1894a) betrachtete das Zürichsee-Tal als<br />
von einer Ur-Sihl, das Glatttal als von einer Ur-Linth<br />
ausgeräumtes Flusstal. Die Wissenschaft glaubte dann<br />
lange Zeit, dass das Zürichsee Becken ein rein von<br />
Gletschern ausgeräumtes Tal sei (PENCK & BRÜCKNER<br />
1909). Die verkitteten Gesteine auf dem Üetliberg <strong>und</strong><br />
Albis wurden als glaziale Schotter der ältesten Kaltzeit<br />
gedeutet, als Teile einer riesigen bis zum Irchel reichenden<br />
Schotterflur. Das ganze Zürichsee Tal wäre<br />
anschliessend innerhalb von 600'000 Jahren bis auf<br />
den Felsgr<strong>und</strong> ausgeräumt worden. Folgende Überlegungen<br />
widersprechen dieser Annahme <strong>und</strong> deuten auf<br />
eine bereits vor den Gletschervorstössen existierende<br />
Hohlform hin. Die „Schotter“ auf Üetliberg <strong>und</strong> Albis<br />
werden nicht mehr als schmelzwasserbedingte Schotterebenen,<br />
sondern nach Untersuchungen von WAGNER<br />
Abb. 1.31 Das Waagtal – Entgegen der weit verbreiteten Meinung<br />
sind nicht die Gletscher, sondern tektonische<br />
Prozesse an der Anlage der Täler beteiligt, was<br />
Kluftmessungen bestätigen (Kap. 4).<br />
(2001c) <strong>und</strong> HANTKE & WAGNER (2003a) als ausgeschmolzenes<br />
Mittelmoränenmaterial gedeutet. Dieses<br />
Lockermaterial wurde durch Schmelzwasser verschwemmt<br />
<strong>und</strong> durch kalkreiches Feinmaterial, durch<br />
„Gletschermilch“, zu „löchriger Nagelfluh“ (Name für<br />
diese Deckenschotter, hat nichts mit der Nagelfluh der<br />
Molasse zu tun) verkittet.<br />
Der ganze Raum der Zürichsee-Talung, der innerhalb<br />
der 600'000 Jahre des Eiszeitalters hätte ausgeräumt<br />
werden müssen, entspricht mindestens 90 km 3 , Scheidegger<br />
errechnete gar 124 km 3 . Eine mittlere Erosionsrate<br />
von 150'000 m 3 pro Jahr wäre nötig. Weil während<br />
der Warmzeiten mit dichter Bewaldung die Erosion<br />
kleiner ist, bleibt für die Ausräumung nur die kurze Zeit<br />
des Eisvorstosses <strong>und</strong> des Abschmelzens bis zur Wiederbewaldung.<br />
Für die Ausräumung stehen daher weniger<br />
als 100'000 Jahre zur Verfügung. Während dieser<br />
Zeit müssten umgerechnet 600'000 m 3 pro Jahr erodiert<br />
werden, was aufgr<strong>und</strong> aktueller Beobachtungen unmöglich<br />
ist. Die Linth hat z.B. von 1910–1931 pro Jahr<br />
nur 126'000 m 3 Verwitterungsschutt aus dem Glarnerland<br />
in den Walensee geschüttet. Das Gefälle im Glarnerland<br />
<strong>und</strong> somit die Erosionsleistung ist einiges höher<br />
als in der Zürichsee-Talung.<br />
29