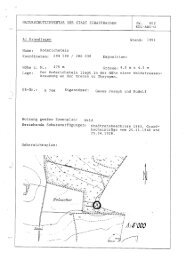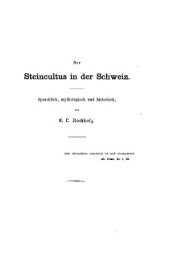Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zur Festlegung von Kluft-Stellungen werden die<br />
Fallrichtungen (Azimut im Uhrzeigersinn von N > E,<br />
Fallwinkel als Neigungswinkel zur Horizontalen,<br />
beide in Grad) angegeben; alle Rechnungen werden<br />
auf die Fallrichtungen bezogen, zur besseren Veranschaulichung<br />
werden die Streichrichtungen, d.h. die<br />
Richtungen der Schnittlinien der Kluftflächen mit<br />
der Horizontalen, verwendet, <strong>und</strong> Richtungsrosen für<br />
die Häufigkeitsverteilung der Streichrichtungen der<br />
steil stehenden Klüfte gezeichnet. Die numerisch<br />
berechneten Häufungsmaxima der Azimute der<br />
Streichrichtungen sind in Tab. 4.2 mit Vertrauensgrenzen<br />
(+) angegeben, bei nicht-parametrischen<br />
Maxima mit + np.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der statistischen Auswertungen von Kluftstellungen<br />
ist es möglich,<br />
1. festzustellen, ob Scharen existieren, <strong>und</strong><br />
2. ihre Richtungen <strong>und</strong> die dazu gehörigen Hauptrichtungen<br />
der neo-tektonischen Hauptspannungen zu<br />
bestimmen. Es ist dann zu untersuchen, ob sie mit<br />
anderen landschaftlich, geomorphologisch, bedeutsamen<br />
Richtungen korrelieren. Trifft dies zu, dann<br />
sind die Richtungen, wie jene der Klüfte, sehr wahrscheinlich<br />
neo-tektonisch vorgezeichnet.<br />
Die Trend-Richtungen der Zuflüsse zu den Seen werden<br />
behandelt wie die Kluft-Streich-Richtungen. Da<br />
Fliessgewässer nicht geradlinig verlaufen, sind ihre<br />
Läufe zu digitalisieren, d.h. aus Karten herauszuzeichnen<br />
(Abb. 4.2–4.4 <strong>und</strong> 4.11), in Abschnitte zu unterteilen<br />
<strong>und</strong> deren Richtungen (Azimut N > E in °) zu<br />
messen. Wegen ihrer fraktalen Struktur sind Kartenmassstab<br />
<strong>und</strong> Digitalisationsschritte belanglos. Die<br />
Zuflüsse zu jedem See werden zusammengefasst <strong>und</strong><br />
wie die Klüfte statistisch ausgewertet. Bei Seen-Ketten<br />
ist als Zufluss des unteren Sees der Abschnitt des<br />
Fliessgewässers bis zu seinem Austritt aus dem nächstoberen<br />
gewertet worden, also die Lorze als Zufluss<br />
zum Zuger See bis zu ihrem Austritt aus dem Ägerisee;<br />
dabei sind die Austritte nicht mehr in die Betrachtung<br />
einbezogen worden. Wegen der im Vergleich zu Klüften<br />
geringen Zahl an Eingabedaten konnten bei den<br />
Seen keine Unterteilung in einzelne Gebiete vorgenommen<br />
werden (z. B. NW-Ufer), sondern nur ihre<br />
gesamten Einzugsgebiete behandelt werden.<br />
Die Auswertungen sind wie bei den Klüften erfolgt: Es<br />
können wieder nicht-parametrische Trend(Streich)rosen<br />
gezeichnet <strong>und</strong> Maxima durch Prüfung bestimmt<br />
oder wieder die Methode von KOHLBECK &<br />
SCHEIDEGGER (1977, 1985) angewendet werden. Dabei<br />
wurde mit Fallrichtungen entsprechender Polrichtungen<br />
gerechnet; da es bei Bächen nicht sinnvoll ist, von<br />
„Fallen“ zu sprechen, wurden nur Streichrichtungen<br />
(Tab. 4.2) aufgelistet.<br />
4.3 Molasseseen<br />
Im Molasse-Vorland liegen Ägerisee, Lauerzer <strong>und</strong><br />
Zuger See (Abb. 4.2).<br />
Die S-Seite des Ägerisees (Abb. 4.2) ist durch die<br />
Molasserippe Schornenboden <strong>und</strong> die Scherstörungen<br />
um Schornen–Tschupplen vorgezeichnet. Das W-Ende<br />
folgt dem Streichen zwischen der Höhronen-Schuppe<br />
im Wiler- <strong>und</strong> Mitteldorfer Berg im N <strong>und</strong> der St. Jost<br />
(=Grindelegg)-Schuppe der Brandflue im S. Tektonisch<br />
zeichnen sich beim Ägerisee zwei Richtungen<br />
ab: N–S im E <strong>und</strong> N117°E im W.<br />
Im Bereich des Ägerisees wurden an acht Stellen in<br />
der Unteren Süsswassermolasse (USM) Kluftstellungen<br />
gemessen, vier davon auf der N-Seite des Sees in<br />
Sandstein- <strong>und</strong> Nagelfluhbänken, zwei am S-Ufer, an<br />
der Nase am Strandweg vom Hauptsee gegen W, wiederum<br />
in Nagelfluh, <strong>und</strong> in Tobeln im mergeligen<br />
Abhang, an dem sich Klüfte erkennen liessen. Ferner<br />
waren eine Sandsteinwand am W-Ausgang von Unterägeri<br />
<strong>und</strong> ein Aufschluss am Durchbruch der Nagelfluh<br />
bei der Schornen-Letzi zugänglich (Abb. 4.2).<br />
Die zum morphologischen Vergleich herangezogenen<br />
Bäche sind in Abb. 4.2 aufgezeigt: auf der N-Seite<br />
deren zwei, auf der S-Seite ein Bach mit Verzweigung.<br />
Der Lauerzer See, einst Teil des Vierwaldstätter Sees<br />
(HANTKE 1991:182ff), verdankt, wie andere seiner<br />
Becken, die Entstehung landschaftsgestaltender Tektonik.<br />
Nach dem eiszeitlichen Abschmelzen des Eises<br />
wurde die ehemalige Verbindung zwischen Vierwaldstätter<br />
<strong>und</strong> Lauerzer See durch Murfächer von Mythen,<br />
Ibergeregg <strong>und</strong> den Schuttfächer der Muota unterbrochen.<br />
Der Trend des Lauerzer Sees verläuft N115°E.<br />
Um den Lauerzer See wurden Kluftstellungen an sieben<br />
Aufschlüssen gemessen (Abb. 4.2), vier am N-<br />
Ufer in der Rigi-Nagelfluh (USM), drei am S-Ufer in<br />
Stad-Mergeln, Kieselkalk <strong>und</strong> Nummulitenkalk.<br />
Die zur morphotektonischen Studie verwendeten<br />
Bäche sind in Abb. 4.2 wiedergegeben. Trotz der<br />
Kleinheit des Sees ist sein Einzugsgebiet bedeutend.<br />
Geologisch verdankt der Zuger See seine Entstehung<br />
dem gegen N zunehmend stärkeren Auseinanderklaf-<br />
87